
Leider läßt der bislang höchst unterschiedliche archäologische Forschungsstand im südlichen Obergermanien keine aussagekräftige, flächendeckende Betrachtung der ländlichen Besiedlung zu. Aus diesem Grund scheint es ratsam, nur auf das derzeit am besten erforschte Teilgebiet, das Territorium der Rauraker und Helvetier in der heutigen Schweiz, zurückzugreifen und die dort exemplarisch getroffenen Feststellungen durch einige Verweise auf die Verhältnisse in der Civitas Lingonum (Hauptort: Langres/Andamantunnum) und der Civitas Sequanorum (Hauptort: Besançon/Vesontio) zu ergänzen.
Beim Siedlungsgebiet der Rauraker und Helvetier, dem Schweizer Mittelland zwischen Alpenrand, Jura, Rhein und Genfer See, handelt es sich um ein im Tertiär entstandenes Becken aus Sandstein, Konglomeratgestein und Mergel, bedeckt von Gletscherschutt und Schottern (siehe dazu u.a. Roth-Rubi 1994, 309). In Richtung auf das Rheinknie bei Basel schließen sich im Nordwesten die Ausläufer des Jura an. Güte und Ertrag des Bodens stehen dabei in unmittelbarer Abhängigkeit von der topographischen Höhe. Im Siedlungsbild der römischen Zeit manifestiert sich dies in einer geringeren Erschließung des Jura- und Alpengebiets sowie einer deutlichen Konzentration der Siedlungsstellen im Bereich der großen Seen und entlang der Flußläufe von Aare, Reuss, Limmat und Rhein.
Im Zusammenhang mit dem geplanten Auszug der Helvetier aus ihren Siedlungsgebieten
im Jahr 58 v.Chr. berichtet C. Iulius Caesar (De bello Gallico I 5):
"
Sobald sie sich hierfür bereit glaubten, zündeten sie alle ihre Städte
(oppida), etwa 12, um die 400 Dörfer (vici) und die restlichen Einzelgehöfte
(aedificia privata) an und verbrannten alle Getreidevorräte außer
denen, die sie mitnehmen wollten..."
Aus dieser Textstelle wird klar, daß zur Infrastruktur des helvetischen
Territoriums neben umwehrten städtischen und dörflichen Anlagen offenbar
auch ländliche Einzelsiedlungen gehörten, deren Anzahl in Fortsetzung
der Aufzählungsreihenfolge vermutlich recht hoch gewesen sein dürfte.
Dennoch ist zu diesen Gehöften, vor allem jenen aus der Zeit nach dem
Gallischen Krieg, bislang nur wenig bekannt. Die Ursachen dieser Kenntnislücke
beruhen zum großen Teil auf der Schwierigkeit, die in leichter Holzbauweise
errichteten späteisenzeitlichen Gebäude, zumal bei der im Betrachtungsgebiet überwiegenden
Bodenbeschaffenheit, archäologisch nachzuweisen. Das fast vollständige
Fehlen von Indizien eisenzeitlicher Vorläufer im Bereich der besser erforschten
römischen Guthöfe (Villae rusticae) ist allerdings auffällig
und schließt zumindest eine Standortkontinuität zwischen den Landsiedlungen
der späten Eisenzeit und der römischen Kaiserzeit in der Regel aus.
Ausnahmen hiervon bilden etwa eine nur in Teilen ergrabene Villa rustica in
Messen (Kt. Solothurn) und der Gutshof von Morat/Murten (Kt. Fribourg). In
Messen gehen die Ursprünge der Villa eventuell auf ein durch einem Graben
umfriedetes Holzpfostenhaus mit weiß getünchten Lehmwänden
aus der Mitte des 1. Jh. v.Chr. zurück, während in Morat/Murten zumindest
Gebäudespuren, Gruben und eine Brandbestattung auf eine Besiedlung seit
dem mittleren 1. Jh. v.Chr. hindeuten. Als derzeit prägnantestes Schweizer
Beispiel für eine Siedlungskontinuität müssen jedoch die Befunde
unter der römischen Villa von "Parc de La Grange" in Genf (Kt.
Genève) genannt werden, auch wenn dieser Fundort schon im Stammesgebiet
der Allobroger (Gallia Narbonensis) und damit knapp außerhalb des obergermanischen
Betrachtungsraumes liegt. Außer Einfriedungsgräben, die chronologisch
bis ins 2. Jh. v.Chr. zurückreichen, konnten hier drei Holzpfosten-/Schwellbalkenbauten
mit einfachen, rechteckigen Grundrissen ohne nennenswerte Binnengliederung
festgestellt werden. Letzte Umbauten an diesen seit dem mittleren 1. Jh. v.Chr.
existierenden Häusern fanden noch in den Jahren zwischen 10v. und 10n.Chr.
statt.
Für ein gewisses Fortleben einheimischer Bautraditionen noch zu Beginn der römischen Herrschaft könnte immerhin die erste Phase des Gutshofes von Laufen-Müschhag (Kt. Bern) sprechen. Der hier in den Jahren 14/20 n.Chr. errichtete, annähernd rechteckige Holzpfostenbau besaß nach Ausweis der Befunde vermutlich Flechtwerkwände mit Lehmverstrich und ein Stroh- oder Schindeldach. Für seine rekonstruierbare Innenraumaufteilung, die durch zwei zweiflügelige Eingangstüren erschlossen wurde, gibt es unter den Hauptgebäuden römischer Gutshöfe bisher keine Entsprechung. Zugehörig ist ein nach Nordosten verlaufender Abwasserkanal mit einer Fassung aus Kalksteinblöcken.
Das vierräumige Haus diente offenbar Leuten zu Wohnzwecken, deren anfängliche Erwerbsquelle unter anderem in der Ausbeutung und Verhüttung von örtlich anstehendem Bohnerz (Konkretion aus Brauneisenstein) bestand. Möglicherweise erst kurz vor der Fertigstellung der 1. Phase eines neuen, steinernen Haupthauses, dessen u-förmige Frontportikus eine Ecke des alten Gebäudes tangiert, wurden der Holzpfostenbau und ein eventuell zugehöriges, zwölfpfostiges Nebengebäude um ca. 60/70 n.Chr. planmäßig niedergelegt.
Vergleichbar rar wie in der Schweiz scheinen gesicherte Siedlungskontinuitäten auch im Gebiet der Sequaner und Lingonen zu sein, soweit der Forschungsstand Aussagen zuläßt. So wurden potentielle Verbindungen zur späten Eisenzeit, wie z.B. bei einer großen Villenanlage in Lux (Dèp. Côte-d'Or / F), deren Ursprünge möglicherweise bis in die Stufe Latène III zurückreichen, meist ebenfalls nur auf Basis des keramischen Fundmaterials erschlossen. Gesicherte Baubefunde bilden bislang ein Desiderat. Immerhin deutet sich für einige Villae, so z.B. die Gutshöfe von Pont-de-Poitte (Dèp. Jura / F) oder Chassey-Lès-Montbozon (Haute Marne / F), dann bereits eine Entstehung in augusteischer bzw. sogar frühaugusteischer Zeit an. Inwieweit sie, wie gelegentlich vermutet, zum Teil als unmittelbar benachbarte Nachfolger eines der zahlreichen, meist unerforschten metallzeitlichen Gehöfte (ferme indigène) angesehen werden können, bleibt allerdings spekulativ.
Sieht man von den wenigen Plätzen mit Hinweisen auf eine Siedlungskontinuität
seit der Spätlatènezeit ab, bahnt sich eine flächige Erschließung
des Helvetier- und Raurakergebietes mit Villae rusticae, also landwirtschaftlichen
Betrieben, erst im ersten Drittel des 1. Jh. n.Chr. an. Das zeitliche Zusammentreffen
mit der Etablierung des Legionslagers von Windisch/Vindonissa (Kt. Aargau)
im Jahre 16/17 n.Chr. hat dabei der Vermutung Raum gegeben, daß diese
Entwicklung in ursächlichem Zusammenhang mit dem durch die ständige
Truppenpräsenz gesteigerten Versorgungsbedarf gesehen werden muß.
Allerdings deutet in der ersten Aufsiedlungsphase nichts auf einen besonderen
Bezug zum Militär oder gar eine in diesem Fall zu erwartende Konzentration
der Gutshöfe im Windischer Umfeld hin.
Auch um die Mitte des 1. Jh. n.Chr.
zeichnet sich in der Siedlungsverteilung noch keine signifikante Änderung
ab. Ein sich scheinbar ergebendes Übergewicht
der Siedlungsstellen in der Nordschweiz ist wohl eher auf den derzeitigen Publikationstand,
als auf die historischen Gegebenheiten zurückzuführen.
Im Verlauf der 2. Hälfte des 1. Jh. n.Chr. ist dann nochmals ein deutlicher
Besiedlungsschub zu verzeichnen, der sich wiederum besonders in der Nordschweiz
bemerkbar macht. Vor allem im vorher weitgehend ausgesparten Umfeld des Legionsstandortes
Windisch (Kt. Aargau) springt die Zunahme der Hofstellen deutlich ins Auge.
Nach derzeitigem Forschungsstand zeichnet sich zudem eine Expansion der Villenlandschaft
im südöstlichen Mittelland bzw. entlang des Alpenrandes, d.h. auch
in topographisch ungünstigere Siedlungsregionen ab. Ein besonders abgelegenes
Beispiel bildet etwa der Gutshof von Alpnach (Kt. Obwalden).
Gegenüber den Besiedungsschüben des vorangegangenen Jahrhunderts
fällt schließlich die Anzahl der erst im 2. Jh. n.Chr. neu angelegten
Villae rusticae stark zurück. Im Betrachtungsgebiet konzentrieren sie
sich im wesentlichen wieder auf die Nordschweiz.
Obwohl das Fundmaterial aus Villen im Sequaner- und Lingonengebiet bisher meist allenfalls summarisch vorgelegt ist, deutet sich auch hier unter den etwas näher datierbaren Siedlungsstellen eine anscheinend recht starke Gründungswelle bereits in der 1. Hälfte des 1. Jh. n.Chr. an. Deren Anfänge reichen offenbar, wie oben bereits ausgeführt, zum Teil noch in die augusteische Zeit zurück. Daran anschließend lassen sich nur vereinzelt Gründungen um die Jahrhundertmitte oder in der 2. Hälfte feststellen, während für die meisten der chronologisch überhaupt fixierbaren Villae rusticae derzeit lediglich ein allgemeiner Siedlungsbeginn im 1. Jh. n.Chr. angenommen werden kann. Potentiell erst während des 2. Jh. n.Chr. errichtete Anlagen sind bisher kaum nachgewiesen.
Trotz eines diesbezüglich nur sehr lückenhaften Forschungsstand
kann man davon ausgehen, daß die im Helvetier- und Raurakergebiet während
des frühen 1. Jh. n.Chr. gegründeten Gutshöfe zunächst
in Holzbauweise errichtet wurden. Wenngleich letztere, wie z.B. bei einer um
50/70
n.Chr. gegründeten Villa in Wetzikon-Kempten (Kt. Zürich), auch noch
im mittleren 1. Jh. n.Chr. gelegentlich zur Anwendung kam, herrschte nun anscheinend
bereits die Steinbauweise vor. Auch ältere Holzanlagen wurden in dieser
Zeit zunehmend in Stein um- bzw. ausgebaut. Im Mittelpunkt diesbezüglicher
Betrachtung steht dabei natürlich vor allem das Haupthaus, während
die Nebengebäude oder gar leichten Stallbauten auch weiterhin häufig
als Holzkonstruktionen fortbestanden oder sogar entsprechend neu errichtet
wurden. So erfolgte z.B. der steinerne Ausbau eines im mittleren 1. Jh. n.Chr.
zu Wohnzwecken angelegten, vermutlichen Nebengebäudes in Aeschi (Kt. Solothurn)
erst an der Wende zum 2. Jh. n.Chr..
Ohnehin ist eine zu scharfe Unterscheidung zwischen Holz- und Steinbauten mit
einiger Vorsicht zu betrachten. Angesichts der mitunter nur in den untersten
Lagen erhaltenen Gebäudefundamente kann nämlich nicht immer sicher
entschieden werden, ob sich die Wände darüber als massive Steinmauern
oder aber Holzfachwerkkonstruktionen auf einem Sockelmauerwerk erhoben. Nur
in wenigen Fällen, so etwa durch die Zusammensetzung des Zerstörungsschutts
der ersten Haupthausphase bei einem um 90/100 n.Chr. gegründeten Anwesen
in Alpnach (Kt. Obwalden), ist letztere Bauweise sicher nachgewiesen.
Eine Auffälligkeit in der Besiedlungsentwicklung des Schweizer Mittelandes
stellen zweifellos die anfängliche Aussparung des unmittelbaren Windischer
Umfeldes und seine dann verstärkte Aufsiedlung mit Villae rusticae im
Verlauf der 2. Hälfte des 1. Jh. n.Chr. dar. Ob sich dahinter, ebenso
wie in der zeitgleichen Erschließung topographisch ungünstigerer
Siedlungsregionen, vielleicht ein geplantes und gelenktes Siedlungsprogramm
verbirgt, ist kaum eindeutig zu beantworten.
Eine regionale Besonderheit bildet immerhin das bei den Villae in der Nordschweiz gehäufte Vorkommen von Ziegeln mit militärischen Stempelabdrücken, das in den germanischen Provinzen und Raetien ohne Parallelen ist.
Vor allem die Stempel der nacheinander in Windisch-Vindonissa (Kt. Aargau) stationierten Legionen XXI Rapax (45/46-69 n.Chr.) und XI Claudia (70-101 n.Chr.) fanden in der 2. Hälfte des 1. Jh. sowohl beim Ausbau älterer Anlagen, wie z.B. in den Steinbauphasen der Gutshöfe von Gränichen (Kt. Aargau), Neftenbach (Kt. Zürich), Triengen (Kt. Luzern) oder Winkel-Seeb (Kt. Zürich), als auch bei Neubauten Verwendung. Gegenüber den mit 1 bis 10 Stücken in der Regel geringen Nachweismengen fällt besonders die Villa von Triengen (Kt. Luzern), aus deren Steinbauphase bislang mindestens 258 Ziegel mit Legionsstempel bekannt sind, deutlich aus dem Rahmen. Doch auch in einer so entlegenen, verhältnismäßig kleinen Anlage wie dem Hof von Alpnach (Kt. Obwalden) wurden insgesamt noch 52 Stempelmarken der Windischer Truppen gefunden.
In der Versorgung ziviler Landsiedlungen mit militärischem Baumaterial scheint sich somit eine bislang nicht näher definierbare Verbindung zwischen dem Militär und den Bewirtschaftern der Villae rusticae anzudeuten. Durchaus vorstellbar wäre, daß es sich bei letzteren, besonders im unmittelbaren Einzugsgebiet des Windischer Legionslagers, vielleicht um Pächter militärischer Liegenschaften auf dem Territorium legionis gehandelt hat. Ebenso erwägenswert scheint ein staatlich initiiertes Landerschließungsprogramm, bei dem das Militär zumindest insofern unterstützend tätig war, daß es privaten Gutshofbesitzern, möglicherweise zu günstigen Konditionen, Baumaterial zur Verfügung stellte. Einige der Produktionsstätten, d.h. der Militärziegeleien, lagen offenbar im Raum zwischen Hunzenschwil und Rupperswil, östlich von Aarau (Kt. Aargau). Selbst noch bei Neugründungen des 2. Jh. n.Chr., wie z.B. Gutshöfen in Döttingen (Kt. Aargau) und Koblenz (Kt. Aargau), wurden entsprechende Ziegel anscheinend in Erstwendung verbaut.
Neben den noch
bis in die 2. Hälfte hinein zu beobachtenden Umstellungen von Holz- auf
Steinbauten, wofür etwa ein Haupthaus in Kallnach (Kt. Bern) ein spätes
Beispiel abgibt, läßt sich in vielen Anlagen ab dem fortgeschrittenen
2. Jh. n.Chr. eine rege Aus- und Umbautätigkeit feststellen. Sie manifestiert
sich häufig vor allem in der Erweiterung der Hauptgebäude und der
Steigerung ihres Ausstattungsluxus, u.a. etwa durch Einbau neuer Mosaikböden,
durch Marmorverkleidungen und Wandmalereien.
Dabei scheint sich spätestens jetzt eine gewisse Häufung vom Villen
mit palastartig ausgebauten Herrenhäusern im Bereich vom Neusiedler-See
bis zum Genfer-See und ein wahrnehmbares Luxusgefälle zur Nordschweiz
hin abzuzeichnen.
Sicherlich spielt die Nähe zum Hauptort der Helvetier in Avenches/Colonia Aventicum (Kt. Vaud), zur Stadt Nyon/Colonia Iulia Equestris (Kt. Vaud), dem großen Vicus Lausanne/Lousonna (Kt.Vaud) und dem am Westende des Genfer Sees gelegenen Hauptort der Allobroger in Genf/Genava (Kt. Genève) eine dabei nicht ganz unwesentliche Rolle.
Die Kenntnisse über die frühen Bauzustände der Gutshöfe
sind bis heute äußerst mangelhaft und oft konnte der Siedlungsbeginn
lediglich auf Basis des vorhandene Kleinfundmaterials, vor allem der keramischen
Hinterlassenschaften, erschlossen werden. Das Vorgehen bei den teilweise bis
ins 18.und 19. Jh. zurückreichenden Altgrabungen, die meist nur einen
Ausschnitt der Hofareale erfassenden Grabungsflächen und die oft widrigen
Bodenverhältnisse behinderten lange die Erkenntnis, daß den leichter
feststellbaren jüngeren Steinbauten der Villae rusticae auch in der Schweiz
wohl meist Holzbauphasen vorausgingen. Entsprechende Befunde aus der 1. Hälfte
des 1. Jh. n.Chr. kennt man immerhin in:
- Buchs (Kt. Zürich).
- Dietikon (Kt. Zürich).
- Laufen (Kt. Bern).
- Le Landeron (Kt. Neuchâtel).
- Möhlin (Kt. Aargau).
- Morrens (Kt. Vaud).
- Neftenbach (Kt. Zürich).
- Triengen (Kt. Luzern).
- Vallon (Kt. Fribourg).
- Winkel-Seeb (Kt. Zürich).
Dabei handelt es sich in der Regel nur um Abschnitte von Wandgräbchen
und um Pfostenlöcher der Holzgebäude sowie mitunter Teile der Hofeinfriedungsgräben.
Von Ausnahmefällen wie dem Gutshof von Laufen (Kt. Bern) abgesehen, bevorzugte
man bei Wohngebäuden offenbar Schwellbalkenkonstruktionen, während
bei Wirtschaftsgebäuden auch häufig die Pfostenbauweise zu beobachten
ist.
Wie die Rekonstruktionszeichnung eines bereits zu Beginn des 1. Jh. n.Chr.
in Vallon (Kt. Fribourg) errichteten Gutshofgebäudes zeigt, waren derartige
Schwellbalkenhäuser, wenn ihrer Fachwerkwände komplett verputzt waren,
optisch mitunter kaum von Steinbauten zu unterscheiden.
Leider reichen an fast keinem der genannten Fundorte die festgestellten Bebauungsspuren aus, um ein vollständiges Gesamtbild einer frühen Hofanlage zu erstellen. Den diesbezüglich bislang noch besten Eindruck vermitteln die Befunde der Villa rustica von Neftenbach (Kt. Zürich).
Im Bereich des jüngeren, steinernen Haupthauses wurde hier um 30 n.Chr. ein erstes Holzgebäude errichtete, an dessen Ausrichtung sich auch noch seine Nachfolger orientierten. Es handelte sich dabei um einen rechteckigen Schwellbalkenbau in Lehnfachwerktechnik mit anscheinend vollständig verputzen Wänden. Das Fehlen von Dachziegeln und der Nachweis von Traufgräben an beiden Schmalseiten läßt auf ein Walmdach mit möglicher Schindeldeckung schließen. Der Vorderfront und einer Schmalseite war eine l-förmige Portikus vorgelagert. Im Inneren des Gebäude konnten zwei gleich große Räume festgestellt werden, von denen einer noch Reste von Wandbemalung aufwies. Interessanterweise scheint ein im rechten Winkel auf die Hauptfront des Gebäudes zuführendes Zaun- oder Heckengräbchen (partiell als Doppelgraben) die Flucht der Trennwand zwischen den beiden Räumen weiter fortzuführen. Hierin sind möglicherweise erste Hinweise auf eine Trennung zwischen dem Nutz-/Wirtschaftsteil (pars rustica) und dem Wohnteil (pars domestica) - sowohl beim Haupthauses als auch bei der Hofanlage insgesamt - zu erkennen. Nordöstlich des Haupthauses konnte in der vermeintlichen Pars rustica ein einfaches Nebengebäude in Holzpfostenbauweise nachgewiesen werden, das wohl Wirtschaftszwecken diente. Die Freifläche zwischen den beiden Gebäude war zumindest teilweise geschottert. Eine Holzwasserleitung (Teuchel), die von einer gefaßte Quelle zu einer Brunnenstube an der Nordwestecke des Haupthauses führte, stellte die Wassersorgung des Hofes sicher. Spuren einer zweiten Teuchelleitung fanden sich nahe des Nebengebäudes.
Hinweise auf eine Hofeinfriedung liegen hingegen erst aus der 2. Gutshofphase vor. Dabei handelt es sich um Hecken- oder Zaungräbchen, die ein offenbar rechteckiges Hofareal umschlossen. Gräbchen und Postenlöcher deuten auf eine Toranlage hin. Den Beginn dieser Phase markiert ein Brand des alten Haupthauses um die Mitte des 1. Jh. n.Chr. und die anscheinend unmittelbar darauf folgende Errichtung eines Neuen. Der gegenüber seinem Vorgänger leicht nach Westen verschobene Bau wurde wiederum als Holzfachbau mit verputzen und bemalten Lehmgefachewänden errichtet. Allerdings hatten seine Schwellbalken nun keinen direkten Bodenkontakt mehr, sondern lagen auf einem niedrigen Sockelmauerwerk auf. Sein Grundriß - mit einer zwischen zwei verspringenden Eckräumen zurückgesetzten Frontportikus - entspricht schon dem besonders bei steinernen Wohngebäuden auf Gutshöfen in den Nordwestprovinzen häufig anzutreffenden Baukonzept der sogenannten "Portikusvilla mit Eckrisaliten". Die noch beim Vorgängerbau zu vermutende Verbindung von Wohn- und Wirtschaftsräumen unter einem Dach ist nun nicht mehr erkennbar. Ein gekiester, von Straßengräben begleiteter Weg führte direkt auf die Front des Haupthauses zu und erschloß über mögliche Querwege das recht große Hofareal, in dem fünf Nebengebäuden in Holzpfostenbauweise lokalisiert werden konnten. Ihre Verteilung folgt keinem ersichtlichen Muster. Auch für eine Binnengliederung des Hofes gibt es keine Anhaltspunkte. Insgesamt neun nahe seiner Einfriedung gelegenen Brandgräber können der vorliegenden Holzbauphase zugerechnet werden. Die Wasserversorgung der Anlage war auch weiterhin durch die von der Vorgängerphase übernommene und ausgebaute Brunnen- und Leitungsanlage garantiert. Ein aus dem Hauptgebäude führender Abwasserkanal deutet jedoch noch auf eine andere Wasserzufuhr hin. Im Verlauf der 2. Holzbauphase entstand nordwestlich des Haupthauses schließlich auch der erste lokale Steinbau in Form eines separaten Badegebäudes. Ein umfangreicherer steinerner Ausbau der Villae rustica von Neftenbach (Kt. Zürich) setzte jedoch erst in den 80er Jahren des 1. Jh. n.Chr. ein.
Das beste Bild über die Anlage und Gliederung der Villa rusticae vermitteln
immer noch deren Steinbauphasen. Über die genauen Ausmaße der Gutshöfe
ist dennoch oft relativ wenig bekannt. Häufig wurden nur das durch massiven
Trümmerschutt auffallende Haupthaus und/oder das durch seine stabile Konstruktion
besser erhaltene Badegebäude erkannt und in Teilen ergraben. Über
die meist in leichterer Bauweise errichteten Nebengebäude liegen insgesamt
deutlich weniger Informationen vor. Flächendeckende Forschungsgrabungen
von Gutshöfen, wie etwa bei der Villa von Orbe (Kt. Vaud), bilden die
Ausnahme. Nicht selten ist die Ausdehnung des Hofareals entweder nur durch
Sondagen im Umfeld bekannter Gebäudestrukturen oder aufgrund der topographischen
Situation erschlossen.
In Bezug auf die Anlage der Gutshöfe in den Nordwestprovinzen, d.h. die
Gliederung ihrer Binnenstrukturen, unterscheidet man zwei Grundmuster:
a) Streuhofanlagen.
b) Axialanlagen.
Bei Streuhofanlagen sind Haupthaus und Nebengebäude derart über das
Siedlungsareal verteilt, daß oft weder ein spezieller Bezug der Baufluchten
aufeinander, noch ein übergeordnetes, axiales Binnengliederungskonzept
der Hofanlage oder eine klare Trennung zwischen Pars urbana und Pars rustica
(d.h. von Wohn- und Wirtschaftsareal) ersichtlich ist. Damit ist die Zusammenfassung
der Bauten in einer gemeinsamen, oft mehr oder minder rechteckigen Einfriedung
nicht ausgeschlossen, auch wenn in machen Fällen bislang keine Umgrenzung
festgestellt werden konnte.
Beispiele solcher Streuhöfe finden sich im Betrachtungsgebiet etwa in:
- Alpnach (Kt. Obwalden).
- Boécourt (Kt. Jura).
- Ferpicloz (Kt. Fribourg).
- Hüttwilen (Kt. Thurgau).
- Langendorf (Kt. Solothurn).
- Laufen (Kt. Bern).
- Maisprach (Kt. Basel-Land).
- Olten, "Im Grund" (Kt. Solothurn).
- Uetendorf (Kt. Bern).
- Wiedlisbach (Kt. Bern).
- Zurzach(?) (Kt. Aargau).
In der Regel handelt es sich dabei um Gutshöfe kleiner bis mittlerer Größe.
Als Referenzbelege für Streuhofanlagen auch im Sequaner- und Lingonengebiet wären etwa die Villa rustica von Tavaux (Dép. Jura / F) und vielleicht der Hof von Selongey (Dép. Côte-d'Or / F) anzuführen.
Axialanlagen orientieren sich in der Regel an der Pars
urbana, in deren Zentrum das Haupthaus steht. Auf dessen repräsentative
Hauptfront sind im Idealfalle die Fluchtachsen der meisten Gebäude, der
Hofmauern und der Hauptzufahrtswege bezogen, so daß sich in der Anlage
der Pars rustica häufig eine
gewisse Bausymmetrie bemerkbar macht. Dies bedeutet jedoch nicht, daß zwangsläufig
alle Gebäude ein spiegelbildliches Pendant besitzen. Generell unterscheidet
man längsaxiale Anlagen, bei denen sich die Pars urbana an eine Schmalseite
des meist mehr oder minder rechteckig umfriedeten Hofareals anschließt,
von queraxialen Gutshöfen, bei denen das Wohnareal an einer der Langseiten
zu finden ist. Charakteristisch ist dabei ihre strikte, durch Mauern oder Gebäuderiegel
unterstrichene Trennung von der Pars rustica. Auch greift das Haupthaus nicht
zwangsläufig exakt die Gebäudeausrichtung im Wirtschaftsbereich auf,
sondern ist gelegentlich leicht gegenüber der allgemeinen Hofachse verdreht
oder schoben. Im interessierenden Betrachtungsraum herrschen längsaxiale
Anlagen vor.
Zu nennen sind beispielsweise:
- Biberist (Kt. Solothurn).
- Buchs (Kt. Zürich).
- Colombier (Kt. Neuchâtel).
- Dällikon (Kt. Zürich).
- Dietikon (Kt. Zürich).
- Liestal (Kt. Basel-Land).
- Neftenbach (Kt. Zürich).
- Oberentfelden (Kt. Aargau).
- Orbe (Kt. Vaud).
- Vicques (Kt. Jura).
- Winkel-Seeb (Kt. Zürich).
- Yvonand (Kt. Vaud).
Es handelt sich dabei durchweg um flächenmäßig große
Gutshöfe.
Vergleichbare Villae rusticae finden sich im Sequanerland z.B. in Vitreux (Dép. Jura / F) oder auf dem Gebiet der Lingonen etwa in Lux (Dép. Côte-d'Or / F).
So unterschiedlich wie die Grundgliederungen der unter dem Begriff Villae
rusticae zusammengefaßten Siedlungen, sind auch ihre Größe
und Bebauung.
An unterster Stelle stehen Bauernhöfe, wie etwa in Boécourt (Kt.
Jura), mit einfachen Wohnhaus, ein bis zwei Nebengebäuden und einer Hoffläche
bis ca. 3 ha. Zur Bewirtschaftung solcher Gehöfte läßt sich
eine Personengruppe im Umfang einer Familie veranschlagen.
Für eine mittelgroße Villa, wie z.B. einen Hof mit ca. 4,5ha in Langendorf (Kt. Solothurn), der neben einem repräsentativeren Hauptgebäude und Wirtschaftsbauten auch ein zu Wohnzwecken dienendes Nebengebäude besitzt, ist dann schon mit einer bedeutend höheren Kopfzahl zu rechnen. Schätzungen gehen hier von einer Gruppe von bis zu 50 Personen aus, die sich aus der Familie des Gutsbesitzers oder -pächters und von ihr abhängigen Familien und/oder Tagelöhnern zusammensetzt (siehe dazu u.a. Schucany 1999, 92).
Die Grenze zur Großvilla ist sicherlich fließend. Sie wird in erster Linie wohl durch eine gesteigerte Anzahl der vom Gutsbesitzer abhängigen Menschen und eine sich daraus entwickelnde stärkere soziale Differenzierung innerhalb der Hofanlage bestimmt. Diese manifestiert sich vor allem in der zunehmenden Trennung zwischen dem nun repräsentativ ausgebauten Domizil des Gutsherren, der Pars urbana, und dem Wirtschaftsteil, der Pars rustica. Letzterer enthält sowohl reine Ökonomiebauten als auch Nebengebäude mit Wohnräumen, die in ihren Dimensionen und Bauformen zum Teil an die Haupthäuser kleinerer Villae rusticae heranreichen können. So liegt etwa die geschätzte Einwohnerzahl eines Gutshofs wie jenem von Biberist (Kt. Solothurn), der ein Areal von ungefähr 5,5ha einnimmt, immerhin bereits bei rund 120 Menschen.
Wenngleich dabei natürlich immer die bebaute Fläche, d.h. die Gebäudekapazität berücksichtigt werden muß, so kann man sich doch vorstellen, daß dann in der Villa von Orbe (Kt. Vaud), der mit mindestens 400 x 400m (16ha) bislang größten Hofanlage im Helvetiergebiet, mehrere hundert Menschen gelebt haben könnten. Nicht ohne Grund wurden vergleichbare Siedlungen, so etwa die Villa rustica von Lux (Dép. Côte-d'Or / F) im Gebiet der Lingonen, in der Forschung gelegentlich schon als Vicus eingestuft. Zumindest von ihrer Infrastruktur her, die neben Wohngebäuden, Werkstätten und Stallungen in mehreren Fällen auch Heiligtümer beinhaltet, kommen sie einem solchen auch durchaus nahe.
Zu den am besten erforschen Bestandteilen der Villae rusticae gehören
das Wohnhaus des Guthofbesitzers oder -pächters, das allgemein als Herren-
oder Haupthaus bezeichnet wird, und die in ihm direkt integrierten oder in
ein separates Nebengebäude ausgegliederten Baderäume. In der Regel
präsentieren sich die Gebäudegrundrisse als ein Produkt verschiedener
Um- und Ausbauten in der Zeit zwischen der 2. Hälfte der 1. Jh. und dem
späten 3./4. Jh. n.Chr.. Auf Grund der summarische Aufnahme der Befunde
und Funde bei vielen Altgrabungen und Baubeobachtungen ist die Trennung einzelner
Bauphasen mitunter kaum möglich und fußt gelegentlich nur auf Annahmen
bzw. Übertragungen anderenorts beobachteter Entwicklungsmuster. Vielen
verschachtelten Anlagen scheint jedoch ein einfacher Ursprungsbau zugrunde
zu liegen, der sich in der Regel entweder dem sogenannten "basilikalen" Bautyp,
dem Zentralhof-Typ oder dem Haustyp der "Portikusvilla" zuordnen
läßt.
Unter dem "basilikalen" Typ versteht
man Gebäude, deren rechteckiger
Kernbau, bei dem es sich häufig um eine Hallenkonstruktion handelt, einem
dreischiffiges Gliederungsprinzip folgt. Als prägnantestes schweizer Beispiel
ist das um die Mitte des 1. Jh. n.Chr. errichtete Haupthaus der Villa von Hölstein
(Kt. Basel-Land) zu nennen. Doch auch ein so großflächig ausgebautes
Haupthaus wie das der Villa von Winkel-Seeb (Kt. Zürich) geht anscheinend
auf einen basilikalen Bau mit Portiken zurück, der hier mit Beginn der
Steinbauphase im mittleren 1. Jh. n.Chr. greifbar wird.
Beim Zentralhof-Typ handelt es sich hingegen um Anlagen, bei denen sich die Räume in streifenartigen Gebäudeflügeln um einen zentralen Innenhof gruppieren. Als Alternativbegriff wird gelegentlich auch von einer Peristylvilla gesprochen. Dabei ist es eine alte Streitfrage, ob es sich wirklich immer um offene Innenhöfe oder nicht teilweise auch zentrale Hallen gehandelt hat. In der Schweiz liegen u.a. Beispiele aus Bennwil (Kt. Basel-Land) und Triengen (Kt. Luzern) vor.
Die bei Villae rusticae des Helvetier- und Raurakergebiet am häufigsten
vertretene Bauform ist schließlich die sogenannte "Portikusvilla",
deren Räumlichkeiten in erster Linie über eine der Hauptfront des
Gebäudes vorgelagerte, repräsentative Portikus erschlossen werden.
Vor allem bei stärkeren Hanglagen ist der häufig über eine zentrale
Freitreppe zugängige offene Säulengang nicht selten noch durch ein
gedeckter Gang (Kryptoportikus) unterbaut. Unter dem gemeinsamen Oberbegriff
der Portikusvilla verstecken sich wiederum mehrere Bauvarianten.
In der einfachsten Form verläuft vor der Gebäudefront eine durchgängige,
gerade Portikus, die gelegentlich noch auf die Schmalseiten des Gebäudes
umbiegen kann. Eine entsprechende Anordnung findet sich sowohl bei Großbauten,
wie möglicherweise in der 3. Ausbauphase (um 200 n.Chr.) der Villa von
Meikirch (Kt. Bern), als auch bei kleinern Anlagen. Zu nennen wären hier
beispielsweise das in flavischer Zeit entstandene erste Haupthaus der Villa
von Orbe (Kt. Vaud) oder die beiden Steinbauperioden des Gutshauses von Schupfart
(Kt. Aargau). Erst im späteren Verlauf der zweiten Periode wurde in Schupfart
schließlich ein risalitartiger Raum an die Portikus angefügt.
Bei der im Untersuchungsgebiet am häufigsten zu beobachtenden Variante, der sogenannten "Portikusvilla mit Eckrisaliten", ist der Säulengang zwischen zwei an den Gebäudeecken vorspringende Räume zurückgesetzt. Das risalitartige Vorspringen nur einer der Gebäudeecken ist demgegenüber seltener. Diesem Villen-Typ folgen ebenfalls sowohl kleine Gebäude, wie z.B. die Haupthäuser in Bellikon (Kt. Aargau), Grenchen (Kt. Solothurn), Laufen (Kt. Bern) oder Lengnau (Kt. Aargau), als auch Großvillen, so etwa in Buchs (Kt. Zürich) oder Worb (Kt. Bern). Je nach Vorsprung der Eckräume können die Portiken, statt wie in den meistens Fällen gerade zu verlaufen, gelegentlich auch entlang der Risaliten abknicken und somit ein U-Form beschreiben.
U-förmige Säulengänge sind vor allem für die dritte
Bauvariante der Portikusvillen, die in erster Linie bei großflächigen
Gebäuden Anwendung gefunden hat, charakteristisch. Die Eckrisalten
sind hier zu mehrräumigen Gebäudeflügel erweitert, so daß man,
in Verbindung mit dem Haupttrakt/-flügel des Gebäudes, von einer
dreiflügeligen Portikusvilla sprechen kann. Nicht selten sind auch
noch die Enden der Seitenflügel durch eine Portikus miteinander verbunden
oder stoßen an den trennenden Gebäuderiegel oder die Mauer zur
Pars rustica an. Auf diese Weise entsteht ein in sich geschlossener Hof
vor der Hauptfront der Villa. Wie entsprechende Befunde von Heckengräbchen
aus Dietikon (Kt. Zürich) vermuten lassen, scheint er wohl nicht selten
einen repräsentativen Ziergarten beherbergt
zu haben. |
Ein besondere Gestaltungsvariante ist
dabei in der Villa von Orbe (Kt. Vaud) zu beobachten, wo der Hofraum
noch durch einen mittige Doppelportikus
in zwei
Einzelhöfe unterteilt war. Von diesen wurde der eine durch Säulengänge
in tuskanischer, der andere in korinthischer Ordnung umschlossen. Im Zentrum
beider Hofteile lag je ein Zierbrunnen. |
Wie schon die letzten Beispiele vermuten lassen, zeigt sich in den Villae
rusticae zum Teil ein beachtlicher Ausstattungsluxus. Dies gilt durchaus nicht
nur für die Großanlagen. So sind, trotz gewisser Abstufungen, auch
die Haupthäuser kleinerer Gutshöfe im Rauraker- und Helvetiergebiet
gegenüber Gutshäusern in einigen anderen Teilen der germanischen
Provinzen oder Raetiens vergleichsweise recht üppig ausgestattet.
So kommen neben einfarbig oder mehrfarbig getünchten Wänden auch
Wandmalerein nicht nur in Herrenhäusern, wie Buchs (Kt. Zürich) oder
Meikirch (Kt. Bern), sondern ebenso in kleineren Villen, wie z.B. Wetzikon-Kempten
(Kt. Zürich), Bellikon (Kt. Aargau) oder Hölstein (Kt. Basel-Land),
vor. Daß es sich dabei keinesfalls nur um provinzielle Ausstattungen
handelt, dürften etwa Wanddekorationen im 3. pompejianischen Stil aus
den Villen von Commugny (Kt. Vaud) oder Yvonand (Kt. Vaud) verdeutlichen.
Neben Wandmalerein wurden zudem an nicht wenigen Orten Bodenplatten und Wandverkleidungsteile aus Jurakalk bzw. -marmor beobachtet, die, wie etwa in Buchs (Kt. Zürich), zum Teil sogar figürliches Reliefdekor aufweisen können.
Vereinzelt nachgewiesene Opus sectile-Verkleidungen und -Böden, so in
Buix (Kt. Jura) oder Orbe (Kt. Vaud), vor allem aber die in zahlreichen schweizer
Villen vorkommenden Mosaike, komplettieren schließlich den optischen
Eindruck der Innenausstattung.
So gibt es in insgesamt 49 von 109 im vorliegenden Aufsatz erfaßten
Villae rusticae im schweizerischen Teil der Germania superior Hinweise auf
Mosaikböden. Zieht man zudem den
schlechten Erhaltungszustand mancher Anlagen und ihre nur ausschnitthafte archäologische
Erfassung in Betracht, ist eher mit einem ursprünglich noch höheren
Anteil zu rechnen. Die Musterpalette reicht von einfachen geometrischen Schwarz-/Weißmosaiken
bis hin zu farbigen Böden mit zahlreichen Bildfeldern. Chronologisch lassen
sich die in den Villen heute noch greifbaren Mosaiken allerdings fast ausschließlich
erst den jüngeren Ausbauphasen der Haupthäuser im fortgeschrittenen
2. bis frühen 3. Jh. n.Chr. zuordnen. Während sie in den großen
Herrenhäusern auch in Repräsentations-/Wohnräumen und Portiken
verlegt wurden, scheinen sie sich bei kleineren Bauten häufig nur auf
den Badetrakt zu konzentrieren. Letzteres Phänomen zeichnet sich auch
schon bei Wanddekorationen und besonders Auskleidungen mit Jurakalk- und Marmorplatten
ab.
Auch bei der Installation von Heizungsanlagen (hypocausta) übernimmt
der zum Teil als erstes Steingebäude errichtete Badetrakt oft die Vorreiterrolle.
Wiederum bleibt bei kleineren Haupthäusern derartiger Ausstattungsluxus
in der Regel auf die nicht selten erst sekundär ein bzw. angebauten Baderäume
beschränkt, so z.B. in Bellikon (Kt. Aargau) oder Hölstein (Kt. Basel-Land).
Hingegen sind in mittleren und größeren Villen, anscheinend vor
allem nach Ausbauten im Verlauf des 2. Jh. n.Chr., auch in den Wohntrakten
häufig Räume mit Fußbodenheizungen belegt.
Badeanlagen kommen im Rauraker- und Helvetiergebiet sowohl als integrierter
Bestandteil des Haupthauses als auch als separates Nebengebäude
vor. Nicht selten wurden separte Bäder allerdings im späteren Verlauf
der baulichen Ausgestaltung der Villa bzw. der Pars urbana durch eine Portikus
oder einen Zwischentrakt mit dem Haupthaus verbunden.
In einem Verhältnis von ca. 3:2 scheinen integrierte Bäder leicht zu überwiegen, was gemessen am Aufwandsunterschied zwischen dem Ein- oder allenfalls Anbau eines oder mehrer Baderäume und der Errichtung eines selbständigen Gebäudes auch nur bedingt überrascht. In einigen Fällen, wie z.B. in Orbe (Kt. Vaud), wo offenbar ein sehr großer Badetrakt des jüngeren Haupthauses das separate Thermengebäude des Vorgängerbaus ersetzte, oder in Winkel-Seeb (Kt. Zürich), wo ein separates Badegebäude am Ostflügel des Haupthauses zumindest zeitweise neben einem integrierten Bad im Westflügel bestand, sind auch beide Bauvarianten belegt. Weitere Beispiele hierfür finden sich u.a. in den Villen von Buchs (Kt. Zürich), Colombier (Kt. Neuchâtel), Kloten (Kt. Zürich) oder Oberweningen (Kt. Zürich). Dabei fügte man, zumindest in den beiden letztgenannten Haupthäusern, die integrierten Anlagen offensichtlich erst in jüngeren Ausbauphasen zusätzlich zu bestehenden separaten Badegebäuden ein.
Die Wasserversorgung der Bäder bzw. der Gutshöfe allgemein wurde
entweder durch Bachläufe, Wasserleitungen oder Brunnen garantiert. Bachläufe
durchqueren u.a. das Gelände der Villen von Biberist (Kt. Solothurn) oder
Dietikon (Kt. Zürich), während Aquaeducte etwa in Orbe (Kt. Vaud)
oder Neftenbach (Kt. Zürich) belegt sind. In Neftenbach ersetzte beispielsweise
eine eventuell bis zu 1,5km lange Steinleitung die ältere Holzleitung
(Teuchelleitung), die den Gutshof in seinen ersten Phasen mit Wasser aus einer
nahegelegenen Quelle versorgt hatte.
Vergleichweise selten wurden bislang in Villen des Helvetier- und Raurakergebietes
Tiefbrunnen festgestellt. Ein mögliches Konstruktionsbeispiel bietet etwa
ein Brunnen in Laufen (Kt. Bern), dessen runde Steinwandung in etwa 5,50m Tiefe
auf einem rechteckigen, hölzernen Sickerkasten aufsaß. Ein reine
Steinkonstruktion mit einer Wandung aus Bollensteinen bzw. Geröllen ist
hingegen auf dem Gutshof von Winkel-Seeb (Kt. Zürich) belegt. Der 6m tiefe
Brunnen war hier in ein aufwendiges Brunnenhaus integriert, das in der Mittelachse
der Pars rustica unmittelbar vor der Hoftrennmauer zur Pars urbana und damit
zentral vor der Front des Haupthauses lag. Die erhaltenen Baureste lassen auf
ein turmartiges Gebäude schließen, in dem das Wasser, vermutlich
mittels mechanischer Hebevorrichtungen, ins oberste Geschoß gezogen wurde,
um von dort aus über eine Druckleitung ins Herrenhaus zu gelangen. Zur
Erreichung dieses Zwecks macht die Topographie des Geländes eine Gebäudehöhe
von über 9m notwendig.
Ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Bauformen präsentiert
sich bei der Betrachtung der Nebengebäude in Villae rusticae. Als reine
Zweckbauten decken sie den gesamten Gebäudebedarf eines ländlichen
Wirtschaftbetriebes, angefangen von Wohngebäuden über Werkstätten,
Speicherbauten, Remisen und Stallungen bis hin zu Viehpferchen mit Unterstand
ab. Entsprechend
breit und unterschiedlich gut archäologisch faßbar ist auch die
Palette ihrer Konstruktionen, die von einfachen Pfostensetzungen/-bauten über
Fachwerkkonstruktionen ohne und mit Sockelmauerwerk bis hin zu Steingebäuden
reicht, deren Fundamentierung mehr als nur eine ebenerdige Bauweise gestattete.
Einen an die Gutshofgröße gekoppelten Durchschnittswert für
die Anzahl der Nebengebäude gibt es nicht. Auf der einen Seite stehen
Kleingehöfte, wie z.B. ein Anwesen in Boécourt (Kt. Jura), zu dem,
außer dem steinernen Haupthaus mit Anbau und einem möglichen Badegebäude,
noch eine Holzhütte, ein aufgestelzter kleiner Speicher und einem Viehpferch
gehörten. Die andere Seite bilden hingegen Großbetriebe wie Neftenbach
(Kt. Zürich) mit wenigstens 15 Nebengebäuden, Oberentfelden (Kt.
Aargau) mit mindestens 19 nachgewiesenen Begleitbauten oder gar Dietikon (Kt.
Zürich) mit allein wohl an die 29 rekonstruierbaren, meist steinernen
Wohn- und Wirtschaftsbauten innerhalb der Pars rustica. Leichtbauten, wie Stallungen
und Pferche, sind bei letzteren Angaben gar nicht erst berücksichtigt.
Dabei reichen manche der in den Großvillen kaum auffallenden Nebenbauten
in ihrer Größe schon an die Haupthäusern kleiner Gutshöfe
heran. Die Zweckbestimmung der Nebengebäude ist oft schwierig. In der
Regel geht man bei solideren Bauten mit kleinräumiger Grundrißgliederung
in Verbindung mit einfachen Lehm- oder Mörtelestrichen, Herdstellen und
entsprechenden Siedlungsabfällen (Trachtfragmente, zerscherbte Gebrauchskeramik,
Tierknochen etc.) von einer Wohnnutzung aus. Einige der Häuser greifen
dann auch Bauelemente auf, die einem ebenso in den Grundrissen der Hauptgebäude
begegnen. So sind vorgelagerte Portiken u.a. bei Nebengebäuden in Buchs
(Kt. Zürich) oder Neftenbach (Kt. Zürich), vorspringende Eckräumen
etwa in Oberentfelden (Kt. Aargau) oder Orbe (Kt. Vaud) und zentrale Höfe
beispielsweise in Aeschi (Kt. Solothurn) oder Biberist (Kt. Solothurn) zu finden.
Nicht selten scheinen Nebengebäude zu Wohn- und Arbeitszwecken gleichermaßen
genutzt worden zu sein. Dies verdeutlichen unter anderem etwa drei nebeneinander
an der nordöstlichen Hofeinfriedungsmauer der Pars rustica der Villa von
Dietikon (Kt. Zürich) gelegene Bauten. Die ca. 10-10,5 x 9m großen,
einräumigen Steingebäude wiesen in ihrem Inneren eine Zweiteilung
mittels einer anfänglich nur als Holzpfostenkonstruktion ausgeführten,
später teilweise schwach fundamentierten Leichtbauwand auf. Pfostenlöcher,
Gräbchen und schwache Fundamente im Umfeld der Gebäude lassen auf
ihnen vorgesetzte Portiken, leichte Anbauten und selbständige weitere
Baustrukturen schließen.
Beim mittleren der drei Gebäude (A)
deutet neben dem typischen Siedlungsabfall aus Planierschichten und Gruben
eine unmittelbar
neben dem Haus entdeckte Neugeborenen-Bestattung
auf eine Wohnnutzung hin, während eine wohl als Esse zu interpretierende
Feuerstelle, verschiedene Schmiedewerkzeuge, Roheisenbarren, Gußformen
und Tiegel, die im Haus und dessen Umfeld gefunden wurden, für gleichzeitige
Eisen- und Buntmetallverarbeitung sprechen. Inwieweit dieses Wohn-/Werkstattgebäude
und der nördlichen benachbarte Bau (L), der dem Fundmaterial zufolge
ausschließlich als Schmiedewerkstatt gedient haben könnte, zusammengehörten,
ist dabei nicht ganz klar.
Im südlich des Haus A gelegenen Gebäude B ist wiederum eine Zweiteilung des Innenraumes in einen größeren, anscheinend kontinuierlich genutzten Wohnraum mit zentraler Feuerstelle und einen schmaleren Wirtschaftsraum mit eigenem Tor feststellbar. Letzteres wurde in einer späteren Ausbauphase durch einen Räucherofen zugesetzt, während man im nun abgetrennten hinteren Teil des gleichen Raumes einen Mörtelestrich einbrachte, unter dem sich noch zwei Neugeborenen-Bestattungen fanden. Ein in Leichtbauweise errichteter Anbau an der Nordwestseite des Gebäudes diente u.a. wohl als Wagenunterstand und Geräteschuppen. Ein deutlich kleinerer Unterstand scheint ebenso an der Südostseite des Hauses existiert zu haben. Nur einige Meter davon entfernt stieß man auf die Bestattung eines Schweins. Während einerseits Zimmermanns- und Metallbearbeitungswerkzeuge, Pferdegeschirr- und Wagenteile die handwerklichen und viehhalterischen Tätigkeiten der Hausbewohner unterstreichen, illustrieren andererseits zahlreiche Münzen und Keramikfunde, Möbel- und Kästchenbeschläge, ein Thekenbeschlag, ein Bratrost, Melonenperlen, eine Fibel, ein Fingerring, ein Spiegel, ein Ohrlöffel, ein Spinnwirtel und eine bronzene Statuettenbasis mit Lötspuren, ihr Privatleben. Ähnliche Nutzungsbefunde wie in den drei vorgestellten Bauten weisen noch weitere erforschte Gebäude gleicher Bauart in Dietikon (Kt. Zürich) sowie praktisch identische Einraumhäuser entlang der Hofmauern der Villa von Neftenbach (Kt. Zürich) auf. Allerdings ist auch in etwas komplexeren Nebengebäuden eine entsprechende Kombination von Wohn- und Wirtschafträumen nachgewiesen. So beispielsweise in Bau B von Winkel-Seeb (Kt. Zürich) durch einen Räucher- und einen Töpferofens, oder durch eine Bronzegießgrube im großflächigen Haus-/Hofgebäude 60 in Neftenbach (Kt. Zürich). An handwerklichen Tätigkeiten gibt es neben häufigeren Belegen für Metallverarbeitung und sogar Eisenverhüttung, wie etwa im Falle der Villa von Laufen (Kt. Bern), auf den Gutshöfen ansonsten vor allem Hinweise auf eine Produktion von Bau- und Gebrauchskeramik. So wurde in Triengen (Kt. Luzern), Vicques (Kt. Jura) und eventuell auch in Laufen (Kt. Bern) ein Ziegelbrennofen betrieben. Gesichert ist an letzterem Fundort, ebenso wie in Obfelden (Kt. Zürich), aber zumindest ein Keramikofen, während aus Vallon (Kt. Fribourg) Indizien auf die Ausbeutung lokaler Tongruben vorliegen.
Daß die Produktion dabei nicht immer nur der Deckung des Eigenbedarfs diente, zeigt sich am Beispiel der oben schon genannten Töpferei in der Villa rustica von Winkel-Seeb (Kt. Zürich), deren Produkte auch noch auf anderen Fundplätzen in der Umgebung nachgewiesen werden konnten. Oft schwieriger faßbar als derart auffällige handwerkliche Tätigkeiten ist die landwirtschaftliche Produktion der Gutshöfe. Gegenüber den im Fundmaterial vertretenen Acker-/Feldwerkzeugen, Zugtiergeschirren und Schlachtabfällen liefert der Baubestand der Anlagen hierfür nur selten sichere Anhaltspunkte.
Neben Getreidedarren, von denen beispielsweise vier nebeneinander in einem Gebäude (H) in Dietikon (Kt. Zürich) ergraben wurden, ist deshalb besonders ein hallenartiger Steinbau in Biberist (Kt. Solothurn) erwähnenswert, dessen zu Durchlüftungszwecken ursprünglich auf Pfeilerreihen aufgesetzter Boden keine Zweifel daran läßt, daß es sich um einen Getreidespeicher gehandelt hat. Außer Wohn- und Werkstattgebäuden sind in seiner Umgebung zudem noch einige Bauspuren belegt, die sich als Viehpferche und leichte Stallungen deuten lassen. Auf diese Weise kann hier ein begrenzter Ausschnitt des Gutshofs recht gut rekonstruiert werden.
Der genaue Zweck der meisten hallenartigen Bauten, so etwa der Gebäude C und D in der Pars rustica von Winkel-Seeb oder eines Nebengebäudes der Villa von Laufen (Kt. Bern), ist hingegen offen. Je nach Torbreite werden hierin meist Scheunen, Stallungen, Speicherbauten und Remisen für Wagen vermutet.
| Eine Gruppe von Gebäuden, die man im ersten Moment wohl eher nicht mit einem landwirtschaftlichen Produktionsbetrieb in Verbindung bringen würde, sind sicherlich Heiligtümer. Dennoch sind Bauten, für die eine entsprechende Funktion angenommen werden kann, auf mehreren der großen Villae rusticae belegt. Wie Beispiele aus Dietikon (Kt. Zürich) oder Neftenbach (Kt. Zürich) zeigen, nehmen sie gerne die bei den Axialhofanlagen von größeren Gebäuden weitgehend freie Fläche im Zentralbereich der Pars rustica ein oder liegen, wie in Orbe (Kt. Vaud), Yvonand (Kt. Vaud) und eventuell in Dällikon (Kt. Zürich), ganz außerhalb des durch eine Mauer umfriedeten Hofareals. | Während im nur teilweise freigelegten Steingebäude in Dällikon (Kt. Zürich) die geborgenen Kleinfunde, darunter fast ausschließlich kugelige Schüsseln, mehrere Räucherkelche und ein Fragment einer Statuettenlampe, für ein Heiligtum zu sprechen scheinen, sind es in den übrigen Fällen in erster Linie die Bauformen, die Lage und das Fehlen des für Wohn- und Wirtschaftsgebäude sonst typischen Fundmaterialniederschlags, die eine Interpretation als Tempel nahelegen. So weist der zentrale Raum des Gebäudes in Orbe (Kt. Vaud), mit einer Apsis an der Stirnwand und den Fundamenten von Liegebänken entlang der Längswände, klare Merkmale eines Mithraeums auf. | In Neftenbach (Kt. Zürich) handelt es sich hingegen nur um einen quadratischen Bau mit dem zentralen Fundament einer möglichen Kultfigurbasis, während das Heiligtum in Yvonand (Kt. Vaud) und zwei sicher als Kultbauten anzusprechende Steingebäude in der Pars rustica von Dietikon (Kt. Zürich) den für gallo-römische Umgangtempel charakteristischen Grundriß mit zentraler Cella und rechteckigem Umgang erkennen lassen. Eventuell ein drittes Heiligtum, möglicherweise in Form eines kleinen Podiumstempels, lag auf letzterem Guthof zudem in der Pars urbana, nur ein Stück von der Vorderfront des Hauptgebäudes entfernt. |
Darüber hinaus sind kleine kapellenartige Begleitbauten sowohl bei einem der Tempel (G) in Dietikon (Kt. Zürich) als auch neben dem Heiligtum in Yvonand (Kt. Vaud) belegt. Mit Ausnahme des Mithraeums in Orbe (Kt. Vaud) und eventuell eines möglichen Quellheiligtums, von dem sich westlich des Haupthauses der Villa von Liestal (Kt. Basel-Land) noch Teile einer Quellfassung, eines Badebassins, ein Hausaltar und Säulenreste erhalten haben, gibt es über die praktizierten Kulte und auch den regionale Wirkungskreis der hofeigenen Kultanlagen leider keinerlei Anhaltspunkte. Bemerkenswert ist immerhin, daß der größte Tempel (G) in Dietikon (Kt. Zürich) nach den verheerenden Zerstörungen des Gutshofes durch die Germaneneinfälle um die Mitte und im dritten Viertel des 3. Jh. n.Chr. wieder aufgebaut und noch bis zum mittleren 4. Jh. n.Chr. weitergenutzt wurde, während das Haupthaus und die meisten anderen Gebäude der Villa in Trümmern lagen. Die eingeschränkte Weiternutzung einiger Nebengebäude in der Pars rustica und einzelner Räumlichkeit in der Haupthausruine hängen vielleicht mit der Fortdauer eines für die Region potentiell bedeutsamen Kultbetriebs zusammen. Alternativ muß man hier natürlich ebenso eine stark reduzierte Fortführung des landwirtschaftlichen Betriebes, eventuell durch ehemalige Bewohner der Pars rustica, in Erwägung ziehen.
Zu den charakteristischen Elementen der Villae rusticae im den Nordwestprovinzen gehört die Einfriedung des bebauten Hofareals mit einem Zaun, einer Hecke, einem Graben oder einer Mauer. Über entsprechende Begrenzungen bei kleineren und mittleren Gehöften ist im Helvetier- und Raurakergebiet bislang relativ wenig bekannt, was zum Teil an der nur ausschnitthaften Erforschung der Anlagen liegen mag. Immerhin fanden sich etwa in Laufen (Kt. Bern) Abschnitte einer Palisade, deren Pfosten innerhalb eines Gräbchens mit Steinen verkeilt waren. Die Flucht der festgestellten Abschnitte legt einen rechteckigen Einfriedungsverlauf nahe. Umgrenzungen mittels eines Grabens sind beispielsweise vom kleinen Anwesen in Boécourt (Kt. Jura) oder der mittelgroßen Villenanlage von Triengen (Kt. Luzern) belegt. In beiden Fällen bilden sie die Vorläufer für jüngere Steinmauern, die auch in anderen kleineren Gehöften nachgewiesen werden konnten. Sofern die lückenhafte Kenntnis des genauen Mauerverlauf hierzu überhaupt Aussagen zuläßt, dienten entsprechende Begrenzungen bei solchen Anlage in der Regel jedoch nur zur Umzäunung des gesamten Hofareals und nicht zur internen Trennung von Wohn- und Wirtschafsbereich. Ganz anders verhält sich dies bei den großen Axialhofanlagen. Auch bei diesen deuten, etwa in den frühen Phasen der Gutshöfe von Buchs (Kt. Zürich), Dällikon (Kt. Zürich), Dietikon (Kt. Zürich) oder Neftenbach (Kt. Zürich), Gräben bzw. Doppelgräbchen auf zunächst aus Hecken und Zäunen bestehende Einfriedungen hin, die später durch Mauern ersetzt wurden. Die Mauern umschließen in der Regel ein rechteckiges Hofareal, das durch eine interne Trennmauer in die Pars rustica und Pars urbana unterteilt ist. Dabei kann sich der Wirtschaftteil der Villa sowohl an die Pars urbana anschließen, wie z.B. in Neftenbach (Kt. Zürich) und Winkel-Seeb (Kt. Zürich) als auch diese mehrseitig umschließen, wie in Orbe (Kt. Vaud) und vielleicht auch in Biberist (Kt. Solothurn). Der Zugang zu den beiden Hofteilen erfolgt mitunter durch repräsentativ gestaltete Toranlagen, die, entsprechend dem Eingang zur Pars urbana in Neftenbach (Kt. Zürich) oder dem Hofareal von Vicques (Kt. Jura), sogar die Form eigenständiger Torhäuser annehmen können.
Im Gegensatz zum Haupthaus, das in der Regel einen weitgehend freistehenden Bauköper bildet, sind - besonders in der Pars rustica - zudem viele Gebäude derart in die Hofeinfriedung integriert, daß die Hofmauer eine ihrer Außenwände bildet. Dabei kann das eigentliche Gebäude sowohl im Inneren des Hofareals liegen, wie z.B. in Dietikon (Kt. Zürich) oder Oberentfelden (Kt. Aargau), als auch an die Außenseite der Hofmauer anbinden oder mittig auf ihr stehen, wie in Liestal (Kt. Basel-Land) oder Yvonand (Kt. Vaud).
Inwieweit in letzteren Fällen eventuell noch mit einer weiteren, äußeren Umfriedung (etwa durch Hecken etc.) gerechnet werden kann, ist unbekannt. Allerdings verdeutlichen des öfteren ummauerte Annexe, so z.B. in Neftenbach (Kt. Zürich) oder Vicques (Kt. Jura), daß auch außerhalb des eigentlichen Kernbereichs des Hofes noch mit Begrenzungen und umfriedeten Arealen zu rechnen ist.
Nur sehr wenig ist schließlich über die zwangsläufig zu jeder Gutshofanlage gehörenden Gräberfelder bekannt. Dabei ist es nicht verwunderlich, daß die potentiell zu erwartenden, aufwendigen Grabmonumente der Besitzerfamilien größerer Villen bislang nicht faßbar sind. Wie gut untersuchte Beispiele, etwa im Vorfeld von Avenches-Aventicum (Kt. Vaud), zeigen, wurden die häufig in Quaderarchitektur errichteten Großgrabbauten zur Zweitverwendung ihres Baumaterials oft schon in spätrömischer Zeit völlig abgetragen. Mögliche Hinweise auf einen solchen Bau liegen immerhin, u.a. in Form von Kapitellen, vom Hang oberhalb des Haupthauses der Villa von Buchs (Kt. Zürich) vor. Von Grabsteinen, die ebenfalls der Baumaterialgewinnung anheimfielen, sind hingegen einige Exemplare aus dem Bereich des Gutshofes in Liestal (Kt. Basel-Land) erhalten, darunter einer für die Freigelassene Prima und ihre Schwester Araurica. Umschlossene Grabbezirke kennt man beispielsweise aus dem Bereich der Großvilla von Colombier (Kt. Neuchâtel) und dem Gutshof von Biberist (Kt. Solothurn). In Biberist lag der kleine, gesondert ummauerte Grabgarten innerhalb des von der eigentlichen Pars rustica durch eine Mauer abgetrennten, möglicherweise zum Teil schon zur Pars urbana gehörenden Zentralbereichs des Hofes. Bei seiner Anlage um 160/170 n.Chr. wurde eine zuvor in der Nähe gelegene Stallung zunächst abgebrochen, jedoch nach der Aufgabe des Bestattungsplatzes um 235/240 n.Chr. wieder durch eine neue ersetzt. Bestattungen im Inneren der Hofanlage sind u.a. auch aus Neftenbach (Kt. Zürich) bekannt. Bei den hier während der zweiten Holzbauphase (Mitte bis 80er Jahre des 1. Jh. n.Chr.) an drei unterschiedlichen Stellen nahe der Hofeinfriedung Bestatteten handelt es sich nach Ausweis der acht einfachen Brandgräber allerdings kaum um Angehörige der Gutsbesitzerfamilie, sondern wohl eher um abhängige Landarbeiter. Während die zwei südöstlichen Gräbergruppen noch Bezüge zu einigen Nebengebäuden erkennen lassen, liegt die nordwestliche weit von der bekannten Bebauung entfernt. Die Gleichzeitigkeit der ihr zugehörigen drei Gräber und Hinweise auf Doppelbestattungen geben der Überlegung Raum, daß es sich hierbei vielleicht um Opfer einer Krankheit gehandelt haben könnte. Abgesehen von solchen Einzelfällen und dem wohl häufigen Vorkommen von Neugeborenenskeletten, so u.a. in Dietikon (Kt. Zürich) oder wiederum auch Neftenbach (Kt. Zürich), wurden Bestattungen im ummauerten Kernbereich des Hofes bislang eher selten angetroffen. Leider ist auch der Nachweis externer Gräber nicht sehr häufig und darüber hinaus mit zunehmender Entfernung, wie etwa bei einer 1200m vom Haupthaus entfernte Köperbestattung (2./3. Jh. n.Chr.) in Worb (Kt. Bern), der Diskussion unterworfen, inwieweit sie überhaupt noch auf den jeweiligen Gutshof zu beziehen sind. Weitere Hinweis externer, teils bis ins Frühmittelalter fortlaufender Bestattungsplätze liegen u.a. etwa aus Obfelden (Kt. Zürich) und Orbe (Kt. Vaud) vor.
Christian Miks
Agustoni 1992 C. Agustoni, La villa de Morat/Combette. In: Le passé apprivoisé.
Archéologie dans le canton de Fribourg. Exposition Fribourg, 18. septembre-1er
novembre 1992 (Fribourg 1992) 110f.
Agustoni u.a. 1996 C. Agustoni / M. Fuchs, Colonnes et balustrades peintes à Morat.
In: Fuchs 1996, 10f..
Ammann-Feer 1937 P. Ammann-Feer, Eine römische Siedlung bei Ober-Entfelden.
Argovia 48, 1937, 139ff..
Bacher 1990 R. Bacher, Das Badegebäude des römischen Gutshofes Wiedlisbach-Niderfeld.
Arch. Bern 1, 1990, 165ff..
Banateanu u.a. 1996 D. V. Banateanu / M. Golubic / F. Saby, La villa gallo-romaine
de Vallon. In: Fuchs 1996, 27ff..
Barbet 1997 G. Barbet / P. Gandel, Chassey-Lès- Montbozon (Haute-Saône)
- Un etablissement rural gallo-romain. Annales Littéraires de l'Université de
Franche-Comté, 627. Série archéologie n° 42 (Paris
1997).
Bénard u.a. 1994 J. Bénard / M. Mangin / R. Goguey / L. Roussel,
Les agglomérations antiques de Côte-d'Or. Annales Littéraires
de l'Université de Besan¸on, 522. Série archéologie
n° 39 (Paris 1994).
Blondel u.a. 1922 L. Blondel / G. Darier, La villa romaine de la Grange, Genève,
Anz. Schweizer. Altkde. 24, 1922, 72ff..
Boisaubert u.a. 1992 J.-L. Boisaubert / M. Bouyer / T. Anderson / M. Mauvilly
/ C. Agustoni / M. Moreno Conde, Quinze années de fouilles sur le tracé de
la RN1 et ses abords. Arch. Schweiz 15, 1992, 41ff..
Bonstetten 1858 G. von Bonstetten, Die Merkur-Statuette von Ottenhusen, Kt.
Luzern. Der Geschichtsfreund 14, 1858, 100ff..
Bouffard 1942 P. Bouffard, Ein römisches Pflugeisendepot aus Büron.
Ur-Schweiz 6, 1942, 71ff..
Bosch 1930 R. Bosch, Die römische Villa im Murimooshau (Gemeinde Sarmenstorf,
Aargau). Anz. Schweizer. Altkde. 32, 1930, 15ff..
Bosch 1958 R. Bosch, Die römische Villa im Murimooshau (Gemeinde Sarmenstorf).
Heimatkde. aus dem Seetal 32, 1958, 3ff..
Bratschi u.a. 1982 S. Bratschi / P. Corfu / A.-P. Krauer, Le matériel
archéologique recueilli dans la villa de Cuarnens. Etudes de Lettres,
Université de Lausanne No 1, 1982, 77ff..
Bujard u.a. 2002 J. Bujard / J.-d. Morerod, Colombier NE, de la villa au château
- L'archéologie à la recherche d'une continuité. In: Windler
u.a. 2002, 49ff..
Châtelain 1976 H. Châtelain, La villa romaine de Commugny. Helvetia
Arch. 7, 1976, 39ff..
Colombo 1982 M. Colombo, La villa gallo-romaine d'Yvonand-Mordagne et son cadre
rural. Etudes de Lettres, Université de Lausanne No 1, 1982, 85ff..
Courvoisier 1963 J. Courvoisier, Les Monumnets d'art et d'histoire du canton
de Neuchâtel 2 (Basel 1963).
Degen 1957 R. Degen, Eine römische Villa rustica bei Olten. Ur-Schweiz
21, 1957, 36ff..
Degen 1957 R. Degen, Fermes et villas romaines dans le canton de Neuchâtel.
Helvetia Arch. 11, 1980, 152ff..
Demarez 2001 J.-D. Demarez, Rèpertoire archéologique du canton
Jura du 1er siécle avant J.-C. au VIIe siècle après J.-C.
Cahier d'Archéologie Jurassienne12 (Porrentruy 2001).
Deschler-Erb 1999 E. Deschler-Erb, "Made in Switzerland" Kasserollen
vom Typ Biberist. Arch. Schweiz 22, 1999, 96ff..
Deschler-Erb 2003 E. Deschler-Erb, Une applique de bride découverte à Biberist
SO. A propos d'un nouveau type. Jahrb. SGUF 86, 2003, 186ff..
Drack 1943 W. Drack, Die römische Villa von Bellikon-Aargau. Zeitschrift
für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 5, 1943, 86ff..
Drack 1945 W. Drack, Das römische Bauernhaus von Seon-Biswind. Argovia
57, 1945, 221ff..
Drack 1950 W. Drack, Die römische Wandmalerei der Schweiz. Monographien
zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 8 (Basel 1950)
Drack 1959 W. Drack, Neue Entdeckungen zu römischen Gutshöfen im
Kanton Zürich 1958. Ur-Schweiz 23, 1959, 30ff..
Drack 1964 W. Drack, Das römische Brunnenhaus bei Seeb (Gem. Winkel, Kt.
Zürich). Ur-Schweiz 28, 1964, 99ff..
Drack 1964/1967 W. Drack, Der römische Gutshof bei Seeb. Provisorischer
Führer (Zürich 1964 und 1967).
Drack 1967 W. Drack, Die Funde aus der römischen Villa von Grenchen-Breitholz
und ihre Datierung. Jahrb. Solothurn. Gesch. 40, 1967, 445ff..
Drack 1969/1981 W. Drack, Der römische Gutshof bei Seeb. Archäologische
Führer der Schweiz 1 (Basel 1969 u. 1981).
Drack 1970 W. Drack, Der römische Gutshof Seeb. Helvetia Arch. 1, 1970,
38ff..
Drack 1974 W. Drack, Die römische Wandmalerei von Buchs. Arch. Korrbl.
4, 1974, 365f..
Drack 1975 W. Drack, Die Gutshöfe. In: Ur- und frühgeschichtliche
Archäologie der Schweiz 5: Die römische Epoche (Basel 1975) 49ff..
Drack 1976 W. Drack, Die römische Kryptoportikus von Buchs ZH und ihre
Wandmalerei, Archäologische Führer der Schweiz 7 (Basel 1976).
Drack 1978 W. Drack, Ruine eines römischen Herrenhauses in Obermeilen.
Heimatbuch Meilen 1978, 5ff..
Drack 1980 W. Drack, Das römische Herrenhaus von Ottenhusen in der Gemeinde
Hohenrain LU. In: Festschrift G. Boesch (Schwyz 1980) 113ff..
Drack 1990 W. Drack, Der römische Gutshof bei Seeb, Gem. Winkel. Ausgrabungen
1958-1969. Berichte der Zürcher Denkmalpflege, Archäologische Monographie
8 (Zürich 1990).
Drack 1986 W. Drack, Römische Wandmalerei aus der Schweiz (Feldmeilen
1986).
Drack u.a. 1988 W. Drack / R. Fellmann, Die Römer in der Schweiz (Stuttgart-Jona
1988).
Dubois u.a. 2001 Y. Dubois / C.-A. Paratte, La pars urbana de la villa gallo-romaine
d'Yvonand VD-Mordagne. Rapport intermédiaire. Jahrb. SGUF 84, 2001,
43ff..
Ebnöther 1991 C. Ebnöther, Die Gartenanlage in der pars urbana des
Gutshofes von Dietikon. Arch. Schweiz 14, 1991, 250ff..
Ebnöther u.a.1993-1994 C. Ebnöther / J. Leckebusch, Siedlungsspuren
des 1.-4. Jh. n.Chr. in Wetzikon-Kempten. Archäologie im Kanton Zürich
- Ber. Kantonsarch. Zürich 13, 1993-1994, 199ff..
Ebnöther 1995 C. Ebnöther, Der römische Gutshof in Dietikon.
Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 25 (Zürich-Egg 1995).
Ebnöther u.a. 1996 C. Ebnöther / J. Rychener, Dietikon und Neftenbach
ZH: Zwei vergleichbare Gutshöfe?. Jahrb. SGUF 79, 1996, 204ff..
Ebnöther u.a. 2002 C. Ebnöther / J. Monnier, Ländliche Besiedlung
und Landwirtschaft. In: Flutsch u.a. 2002, 135ff..
Eggenberger u.a. 1992 P. Eggenberger / L. Auberson, Saint-Saphorin en Lavaux.
Le site gallo-romain et les édifices qui ont précédé l'église.
Cahiers d'Archéologie Romande 56 (Lausanne 1992).
Engel 1971 J. Engel, Une villa romaine à Marly, Fribourg. Helvetia Arch.
2, 1971, 65ff..
Ettlinger 1946 E. Ettlinger, Die Kleinfunde der römischen Villa von Bennwil.
Tätigkeitsberichte der Naturforschenden Gesellschaft Baselland 16, 1946,
57ff..
Ewald u.a. 1978 J. Ewald / A. Kaufmann-Heinimann, Ein römischer Bronzedelphin
aus Munzach bei Liestal BL. Arch. Schweiz 1, 1978, 23ff..
Felka u.a. 1982 H. Felka / F. Loi-Zedda, La villa gallo romaine de Cuarnens.
Etudes de Lettres, Université de Lausanne No 1, 1982, 49ff..
Fellmann 1949 R. Fellmann, Neues vom "Römerbad" in Zofingen,
Ur-Schweiz 13, 1949, 23ff..
Fellmann 1950 R. Fellmann, Ein Tischfuß aus der römischen Villa
von Rekingen. Ur-Schweiz 20, 1956, 42ff..
Fellmann 1950 R. Fellmann, Die gallo-römische Villa rustica von Hinterbohl
bei Hölstein. Baselbieter Heimatb. 5, 1950, 28ff..
Ferdière 1988 A. Ferdière, Les campagnes en Gaule romaine. 1.
Les hommes et l'environnement en Gaule rurale (52 av. J.-C. - 486 ap. J.-C.)
(Paris 1988).
Fetz u.a. 1997 H. Fetz / Ch. Meyer-Freuler, Triengen, Murhubel. Ein römischer
Gutshof im Suretal. Archäologische Schriften Luzern 7 (Luzern 1997).
Flückiger 1941 W. Flückiger, Die römischen Ausgrabungen in Aeschi
1940
- Vorbericht. Jahrb. Solothurn. Gesch. 14, 1941, 173ff..
Flutsch u.a. 1989 L. Flutsch, Campagne de fouilles à Orbe VD-Boscéaz
1988. Bilan provisoire. Jahrb. SGUF 72, 1989, 281ff..
Flutsch u.a. 2002 L. Flutsch / U. Niffeler / F. Rossi, Die Schweiz vom Paläolithikum
bis zum frühen Mittelalter. 5. Römische Zeit (Basel 2002).
Francillon u.a. 1983 F. Francillon / D. Weidmann, Photographie aérienne
et archéologie vaudoise. Arch. Schweiz 6, 1983, 2ff..
Fuchs 1992 M. Fuchs, Ravalements à Vallon - Les peintures de la villa.
Arch. Schweiz 15, 1992, 86ff..
Fuchs 1996 M. Fuchs, Fresques romaines. Trouvailles fribourgeoises. Catalogue
d'exposition (Fribourg 1996).
Fuchs 2001 M. Fuchs, La mosaïque de dite de Bacchus et d'Ariane à Vallon.
In: Paunier u.a. 2001, 190ff..
Fuchs 2000 M. Fuchs, Vallon. Römische Mosaiken und Museum. Archäologische
Führer der Schweiz 31 (Fribourg 2000).
Fuchs u.a. 2002 M. Fuchs / F. Saby, Vallon entre Empire gauloise et 7e siècle.
In: Windler u.a. 2002, 59ff..
Furrer 1916 A. Furrer, Die römische Baute in Gretzenbach. Anz. Schweizer.
Altkde. 16, 1914, 187ff..
Gardiol 1990 J.-B. Gardiol, La villa gallo romaine de Vallon FR: suite des
recherches. Jahrb. SGUF 73, 1990, 155ff..
Gardiol u.a.1990 J.-B. Gardiol / S. Rebetez / F. Saby, La villa gallo-romaine
de Vallon FR. Une seconde mosaïque figurée et un laraire. Arch.
Schweiz 13, 1990, 169ff..
Germann u.a. 1957 O. Germann / E. Ettlinger, Untersuchungen am römischen
Gutshof Seeb bei Bülach. Jahrb. SGU 46, 1957, 59ff..
Gersbach 1958 E. Gersbach, Die Badeanlage des römischen Gutshofes von
Oberentfelden im Aargau. Ur-Schweiz 22, 1958, 33ff..
Gerster 1923 A. Gerster, Eine römische Villa in Laufen (Berner Jura).
Anz. Schweizer. Altkde. 25, 1923, 193ff..
Gerster 1941 A. Gerster, Römische Villa bei Grenchen. Ur-Schweiz 5, 1941,
8ff..
Gerster 1973 A. Gerster, Der römische Gutshof in Seeb: Rekonstruktionsversuche.
Helvetia Arch. 4, 1973, 62ff..
Gerster 1976 A. Gerster, Römische und merowingische Funde in Develier.
Helvetia Arch. 7, 1976, 30ff..
Gerster 1976a A. Gerster, Ein römisches Ziegellager bei Münchwilen
AG. Helvetia Arch. 7, 1976, 112ff..
Gerster 1983 A. Gerster, Die gallo-römische Villenanlage von Vicques.
Rekonstruktion einer Archäologischen Arbeit von Alban Gerster (Porrentruy
1983).
Gerster-Giambonini 1978 A. Gerster-Giambonini, Der römische Gutshof im
Müschhag bei Laufen. Helvetia Arch. 9, 1978, 2ff..
Glauser u.a. 1996 K. Glauser / M. Ramstein / R. Bacher, Tschugg - Steiacher.
Prähistorische Fundschichten und römischer Gutshof. Schriftenreihe
der Erziehungsdirektion des Kantons Bern (Bern 1996).
Gessner 1908 A. Gessner, Die römischen Ruinen bei Kirchberg. Anz. Schweizer.
Altkde. 10, 1908, 24ff..
Gonzenbach 1961 V. von Gonzenbach, Die römischen Mosaiken der Schweiz.
Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 13 (Basel 1961).
Gonzenbach 1963 V. von Gonzenbach, Die Verbreitung der gestempelten Ziegel
der im 1. Jahrhundert n.Chr. in Vindonissa liegenden römischen Truppen.
Bonner Jahrb. 163, 1963, 76ff..
Gonzenbach 1974 V. von Gonzenbach, Die römischen Mosaiken von Orbe. Archäologische
Führer der Schweiz 4 (Zürich 1974).
Grütter 1963-1964 H. Grütter, Vier Jahre archäologische Betreuung
des Nationalstrassenbaus im Kanton Bern. Jahrb. Bern. Hist. Mus. 43-44; 1963-1964,
471ff..
Grütter u.a. 1965-1966 H. Grütter / A. Bruckner, Der Gallo-römische
Gutshof auf dem Murain bei Ersigen. Bern. Hist. Mus. 45-46; 1965-1966, 373ff..
Haldimann 1985 M.-A., Marly (Sarine). Les Râpettes. Archéologie
fribourgeoise, chronique archéologique 1985, 34ff.
Haldimann u.a. 2001 M.-A. Haldimann / P. André / E. Broillet-Ramjoué /
M. Poux, Entre résidence indigène et domus gallo-romaine: le
domaine antique du Parc de La Grange (GE). Arch Schweiz 24/4, 2001, 2ff..
Haller von Königsfelden 1812/1817 F. L. Haller von Königsfelden,
Helvetien unter den Römern II - Topographie von Helvetien unter den Römern
(Bern-Leipzig 1812; 2. verb. Aufl. 1817).
Hartmann 1975 M. Hartmann, Der römische Gutshof von Zofingen. Archäologische
Führer der Schweiz 6 (Brugg 1975).
Hartmann 1979 M. Hartmann, Zwei römische Gutshöfe im Bezirk Baden.
Badener Neujahrsblätter 54, 1979, 44ff..
Hartmann u.a. 1985 M. Hartmann / H. Weber, Die Römer im Aargau (Aarau-Frankfurt
a.M.-Salzburg 1985).
Hartmann u.a. 1989 M. Hartmann / D. Wälchli, Die römische Besiedlung
von Frick. Archäologie der Schweiz 12, 1989, 71ff..
Hedinger 1997-1998 B. Hedinger, Zur römischen Epoche im Kanton Zürich.
Ber. Kantonsarch. Zürich 15, 1997-1998, 293ff..
Henny 1992 C. Henny, La villa romaine de Commugny. Mémoire d'archéologie
provinciale ramaine présenté à l'Université de
Lausanne (Lausanne 1992).
Heuberger 1915 S. Heuberger, Grabungen der Gesellschaft Pro Vindonissa im Jahre
1914. I. Teil. Reste einer römischen Villa in Rüfenach. Anz. Schweizer.
Altkde. 17, 1915, 274ff..
Hidber u.a. 1997 A. Hidber / K. Roth-Rubi (Hrsg.), Beiträge zum Bezirk
Zurzach in römischer und frühmittelalterlicher Zeit. Separatdruck
aus Argovia 108 (Aarau 1997).
Hinz 1970 H. Hinz, Germania Romana III. Römisches Leben auf germanischem
Boden. Gymnasium Beihefte 7 (Heidelberg 1970).
Hoek u.a. 2001 F. Hoek / V. Provenzale / Y. Dubois, Der römische Gutshof
von Wetzikon-Kempten und seine Wandmalerei. Arch. Schweiz 24/3, 2001, 2ff..
Hofer 1915 P. Hofer, Römische Anlagen bei Ütendorf und Uttigen. Anz.
Schweizer. Altkde. 17, 1915, 19ff..
Horisberger 2002/2003 B. Horisberger, Neue Ausgrabungen im römischen Gutshof
von Oberweningen ZH. Jahresheft des Zürcher Unterländer Museumsvereins
32, 2002/2003, 32ff..
Horisberger 2004 B. Horisberger, Der Gutshof in Buchs und die römische
Besiedlung im Furttal. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich
37 (Zürich-Egg 2004).
Hüsser 1940 P. Hüsser, Das Römerbad in Zurzach. Argovia 52,
1940, 265ff..
Hufschmid 1983/85 M. Hufschmid, Der römische Gutshof von Oberweningen.
Jahresheft des Zürcher Unterländer Museumsvereins 23, 1983/85.
Jahn 1850 A. Jahn, Der Kanton Bern, deutschen Teils, antiquarisch und topographisch
beschrieben (Bern-Zürich 1850).
Joos 1985 M. Joos, Die römischen Mosaiken von Munzach. Arch. Schweiz 8,
1985, 86ff..
Juillerat u.a. 1997 C. Juillerat / F. Schifferdecker, Guide archéologique
du Jura et du Jura bernois (Porrentruy 1997).
Kapossy 1966 B. Kapossy, Römische Wandmalereien aus Münsingen und
Hölstein. Acta Bernensia 4 (Bern 1966).
Kaenel u.a. 1980 H.-M. von Kaenel / M. Pfanner, Tschugg - Römischer Gutshof.
Grabung 1977 (Bern 1980).
Katalog Dijon 1990 Musée Archéologique Dijon, Il était
un fois la Côte-d'Or. 20 ans de recherches archéologiques (Paris
1990).
Keller 1844 F. Keller, Die römischen Gebäude bei Kloten. Mitt. Ant.
Ges. Zürich 1/2, 1844, 1ff..
Keller 1846/1947 F. Keller, Goldschmuck und christliche Symbole gefunden zu
Lunnern im Kanton Zürich. Mitt. Ant. Ges. Zürich 3, 1846/1847, 126ff..
Keller 1864 F. Keller, Statistik der römischen Ansiedlungen in der Ostschweiz.
Mitt. Ant. Ges. Zürich 15/3 (Zürich 1864).
Kühne u.a. 1983 E. Kühne / S. Menoud, Bösingen. Freiburger Archäologie,
Archäologischer Fundbericht 1983, 34ff..
Kunnert 2001 U. Kunnert, Römische Gutshöfe. Zürcher Archäologie
5 (Zurich-Egg 2001).
La Roche 1910 F. La Roche, Römische Villa in Ormalingen. Basler Zeitschr.
Gesch. u. Altkde. 9, 1910, 77ff..
La Roche 1940 F. La Roche, Römische Villa Bennwil. Tätigkeitsberichte
der Naturforschenden Gesellschaft Baselland 11, 1936-1938, 130ff..
Laur-Belart 1925 R. Laur-Belart, Grabungen der Gesellschaft Pro Vindonissa
im Jahre 1923. II. Eine römische Villa in Bözen. Anz. Schweizer.
Altkde. 27, 1925, 65ff..
Laur-Belart 1929 R. Laur-Belart, Grabungen der Gesellschaft Pro Vindonissa
1928. Anz. Schweizer. Altkde. 31, 1929, 92ff..
Laur-Belart 1952 R. Laur-Belart, Der römische Gutshof von Oberentfelden
im Aargau. Ur-Schweiz 16, 1952, 9ff..
Laur-Belart u.a.1953 R. Laur-Belart / T. Strübin, Die römische Villa
von Munzach bei Liestal. Ur-Schweiz 17, 1953, 1ff..
Lehner 1980 H. Lehner, Ausgrabungen in der Pfarrkirche von Meikirch. Arch.
Schweiz 3, 1980, 118.
Lüdin 1984 O. Lüdin, Die archäologischen Untersuchungen in der
Kirche ST. Pankratius von Hitzkirch. Helvetia Arch. 219ff..
Maier-Osterwalder 1989 F. B. Maier-Osterwalder, Ein römisches Gebäude
bei Lengnau-"Chilstet". Arch. Schweiz 12, 1989, 60ff..
Martin-Kilcher 1980 S. Martin-Kilcher, Die Funde aus dem römischen Gutshof
von Laufen-Müschhag. Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte des nordwestschweizerischen
Jura (Bern 1980).
Masserey 1988 C. Masserey, Sondages sur le site Bronze final et gallo-romain
des Montoyes à Boécourt JU. Jahrb. SGUF 71, 1988, 189f..
Meier 1900 S. Meier, Die römische Anlage im Schalchmatthau, Gemeinde Ob.-Lunkhofen.
Anz. Schweizer. Altkde. 2, 1900, 246ff..
Mellet 1899 J. Mellet, Les Fouilles de Buy, entre Cheseaux et Morrens (Vaud).
Anz. Schweizer. Altkde. 1, 1899, 13ff..
Menoud u.a. 1983 S. Menoud / J.-L. Boisaubert / M. Bouyer, Marly-le Grand (Sarine).
Les Râpettes. Archéologie fribourgeoise, chronique archéologique
1983, 54ff..
Meyer-Freuler 1988 C. Meyer-Freuler, Die römischen Villen von Hitzkirch
und Grossdietwil - ein Beitrag zur römischen Besiedlung im Kanton Luzern.
Arch. Schweiz 11, 1988, 79ff..
Mottier 1960/1961 Y. Mottier, Ein neues Ökonomiegebäude des römischen
Gutshofes bei Seeb. Jahrb. SGU 48, 1960/1961, 95ff..
Müller-Beck 1957-1958 H. Müller-Beck, Die Notgrabung 1957 im Bereich
der römischen Villa auf dem Buchsi bei Köniz. Jahrb. Bern. Hist.
Mus. 37-38, 1957-1958, 249ff..
Ott u.a. 1979 E. Ott / H. Kläui / O. Sigg, Die Geschichte der Gemeinde
Neftenbach (Neftenbach 1979).
Paccolat 1989 O. Paccolat, Boécourt JU: La villa gallo-romaine des Montoyes.
Fouilles 1988. Jahrb. SGUF 72, 1989, 286ff..
Paccolat 1991 O. Paccolat, L'établissement gallo romain de Boécourt,
Les Montoyes (JU, Suisse). Cahier d'Archéologie Jurassienne1 (Porrentruy
1991).
Paratte 1994 C.-A. Paratte, Rapport préliminaire sur la campagne de
fouille d'Orbe VD-Boscèaz 1993. Jahrb. SGUF 77, 1994, 148ff..
Paratte u.a. 1994 C.-A. Paratte / Y. Dubois, La villa gallo-romaine d'Yvonand
VD-Mordagne. Rapport préliminaire. Jahrb. SGUF 77, 1994, 143ff..
Paunier 1981 D. Paunier, La céramique gallo-romaine de Genève
(Genève-Paris 1981).
Paunier u.a. 2001 D. Paunier / C. Schmidt (Hrsg.), La mosaïque gréco-romaine
VIII. Actes du 8e Colloque international pour l'etude de la mosaïque antique
et médiévale - Lausanne, 6-11 octobre 1997. Cahiers d'archéologie
Romande 85-86 (Lausanne 2001).
Pavlinec 1992 M. Pavlinec, Zur Datierung römerzeitlicher Fundstellen in
der Schweiz. Jahrb. SGUF 75, 117ff..
Peissard 1943-1945 N. Peissard, Archäologische Karte des Kantons Freiburg.
Beitr. Heimatkde. Sensebezirk 17, 1943-1945, 4ff..
Peter 1995 C. Peter, La villa gallo-romain de Buix dans la vallée de
l'Allaine (JU). Arch. Schweiz 18, 1995, 25ff..
Poget 1934 S.W. Poget, L'Urba romaine. Aper¸u général.
Rev. Hist. Vaudoise 42, 1934, 257ff..
Primas u.a. 1992 M. Primas / P. Della Casa / B. Schmid-Sikimic, Archäologie
zwischen Vierwaldstättersee und Gotthard. Siedlungen und Funde der ur-
und frühgeschichtlichen Epochen. Universitätsforschungen zur prähistorischen
Archäologie 12 (Bonn 1992).
Quiquerez 1844 A. Quiquerez, Notice historique sur quelques monuments de l'ancien
Evêché de Bâle. Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft
Zürich 2, 1844, 85f..
Quiquerez 1862 A. Quiquerez, Le Mont-Terrible (Porrentruy 1862).
Ramstein 1998 M. Ramstein, Worb - Sunnhalde. Ein römischer Gutshof im
3. Jahrhundert (Bern 1998).
Rapin 1982 C. Rapin, Villas romaines de environs de Lausanne. Etudes de Lettres,
Université de Lausanne No 1, 1982, 29ff..
Rebetez 1992 S. Rebetez, Zwei figürlich verzierte Mosaiken und ein Lararium
aus Vallon (Schweiz) - Les deux mosaïques figurées et le laraire
de Vallon (Suisse). Antike Welt 23, 1992, 3ff..
Reymond 2001 S. Reymond / E. Broillet-Ramjoué, La villa romaine de Pully
et ses peintures murales. Guides archéologiques de la Suisse 32 (Pully
2001).
Ribaux u.a. 1984 Ph. Ribaux / G. De Boe, La villa de Colombier. Fouilles récentes
et nouvelle évaluation. Arch. Schweiz 7, 1984, 79ff..
Robert-Charrue 1999 C. Robert-Charrue, La Céramique gallo-romain de
la villa de Vicques (JU, Suisse). Mémoire de licence, Universités
de Neuchâtel et Lausanne (1999).
Rothé 2001 M.-P. Rothé, Le Jura. Carte Archeologique de la Gaule
39 (Paris 2001).
Roth-Rubi 1986 K. Roth-Rubi, Die Villa von Stutheien/Hüttwilen TG. Ein
Gutshof der mittleren Kaiserzeit. Antiqua 14 (Basel 1986).
Roth-Rubi 1994 K. Roth-Rubi, Die ländliche Besiedlung und Landwirtschaft
im Gebiet der Helvetier (Schweizer Mittelland) während der Kaiserzeit.
In: H. Bender / H. Wolf (Hrsg.), Ländliche Besiedlung und Landwirtschaft
in den Rhein-Donau-Provinzen des römischen Reiches. Kolloquium Passau
1991. Passauer Universitätsschr. Arch. 2 (Espelkamp 1994) 309ff..
Roth-Rubi 1987 K. Roth-Rubi / U. Ruoff., Die römische Villa im Loogarten,
Zürich-Altstetten - Wiederaufbau vor 260 n.Chr.? Jahrb. SGUF 70, 1987,
145ff..
Roth-Rubi u.a.1992 K. Roth-Rubi / D. Hintermann, Birmenstorf AG, Huggebüel:
Archäologische Funde noch einmal betrachtet. Jahresber. Ges. Pro Vindonissa
1992, 25ff..
Russenberger 2001 C. Russenberger, Siedlungsbilder der Blütezeit. In:
A. Furger / C. Isler-Kerényi / S. Jacomet / C. Russenberger / J. Schibler,
Die Schweiz zur Zeit der Römer. Multikulturelles Kräftespiel vom
1. bis 5. Jahrhundert. Archäologie und Kulturgeschichte der Schweiz 3
(Zürich 2001) 131ff..
Rychener 1990 J. Rychener, Der römerzeitliche Gutshof von Neftenbach ZH
- Steinmöri. Arch. Schweiz 13, 1990, 124ff..
Rychener 1999 J. Rychener, Der römische Gutshof in Neftenbach. Monographien
der Kantonsarchäologie Zürich 31 (Zürich-Egg 1999).
Saby 1995 F. Saby, Marly (Sarine). Les Râpettes. Archéologie fribourgeoise,
chronique archéologique 1995, 48ff..
Saby 2001 F. Saby, La mosaïque de la Venatio de Vallon et son système
d'évacuation d'eau. In: Paunier u.a. 2001, 328ff..
Scherer 1916 P. E. Scherer, Die römische Niederlassung in Alpnachdorf.
Mitt. Ant. Ges. Zürich 27/4, 1916, 227ff..
Schnyder 1916 W. Schnyder, Die römische Siedlung auf dem Murhubel bei
Triengen, Kanton Luzern. Geschichtsfreund 71, 1916, 259ff..
Schucany 1986 C. Schucany, Der römische Gutshof von Biberist-Spatalhof.
Ein Vorbericht. Jahrb. SGUF 69, 1986, 199ff..
Schucany 1999 C. Schucany, Solothurn und Olten - Zwei Kleinstädte und
ihr Hinterland in römischer Zeit. Arch. Schweiz 22, 1999, 88ff..
Schuler u.a. 1984 H. Schuler / W. E. Stöckli, Die römische Villa
auf dem Niderfeld in Wiedlisbach. Jahrb. Oberaargau 1984, 197ff..
Schwab 1981 H. Schwab, N12 und Archäologie: Archäologische Untersuchungen
auf der N12 im Kt. Freiburg 1981, 28ff..
Spitale 1992 D. Spitale, Les monnaies de la villa gallo-romaine de Vicques.
Actes de la Société jurassienne d'Emulation 95, 1992, 9ff..
Spycher 1976 H. Spycher, Die Ausgrabungen auf den Nationalstrassen im Kanton
Freiburg 1975. Mittbl. SGUF 25/26, 1976, 34ff..
Spycher 1981 H. Spycher, Die Ausgrabungen von Langendorf-Kronmatt 1980. Arch.
Schweiz 4, 1981, 62ff..
Spycher 1981a H. Spycher, Ein römisches Gebäude in Langendorf. Arch.
Solothurn 2, 1981, 21ff..
Strübin 1956 T. Strübin, Monciacum. Der römische Gutshof und
das mittelalterliche Dorf Munzach bei Liestal. Bildbericht über die Ausgrabungen
in Munzach 1950-1955. Baselbieter Heimatblätter 20, 1956, 386ff..
Suter u.a. 1986 T. Suter / E. Suter, Römische Villa Chilstet, Lengnau
AG, Sondiergrabung 1985. Jahresschrift der Historischen Vereinigung des Bezirks
Zurzach Nr. 17, 1986, 1ff..
Suter u.a. 1990 P. J. Suter / F. E. Koenig, Das hangseitige Ökonomiegebäude
des römischen Gutshofes Tschugg-Steiacher. Arch. Bern 1, 1990, 157ff..
Suter u.a. 2004 P. J. Suter / M. Ramstein (Red.), Meikirch: Villa romana, Gräber
und Kirche. Schriftenreihe der Erziehungsdirektion des Kantons Bern (Bern 2004).
Tatarinoff 1908 E. Tatarinoff, Das römische Gebäude bei Niedergösgen
(Solothurn). Anz. Schweizer. Altkde. 10, 1908, 111-123; 213-223.
Terrier 2002 J. Terrier, Découvertes archéologiques dans le canton
de Genève en 2000 et 2001. Genava 50, 2002, 355ff..
Viollier 1927 D. Viollier, Carte archéologique du Canton de Vaud (Lausanne
1927).
Vischer 1852 W. Vischer, Eine römische Niederlassung in Frick im Canton
Aargau. Mitteilungen der Gesellschaft für Vaterländische Altertümer
Basel 4, 1852, 31ff..
Vouga 1943 D. Vouga, Préhistoire du pays de Neuchâtel des origine
aux France (Neuchâtel 1943).
Wavre 1905 W. Wavre, Ruines romaines à Colombier. Nusée Neuchâtelois
1905, 153ff..
Weidmann 1978 D. Weidmann, L'établissement romain d'Orbe/Boscéaz.
Arch. Schweiz 1, 1978, 84ff..
Weidmann 1978a D. Weidmann, La villa romaine du Prieuré à Pully.
Arch. Schweiz 1, 1978, 87ff..
Wiedemer 1965 H.-R. Wiedemer, Römer und Alemannen in der Gegend des Sisselnfeldes.
Roche-Zeitung 1965-1, 16ff..
Windler u.a. 2002 R. Windler / M. Fuchs (Hrsg.), De l'Antiquité tardive
au Haut Moyen-Âge (300-800) - Kontinuität und Neubeginn. Antiqua
35 (Basel 2002).
Bei den zuvor umrissenen Landschaften handelt es sich noch bis in die Zeit vor dem Gallischen Krieg (58-51 v.Chr.) durchweg um das Siedlungsgebiet keltischer Stämme. Diese Feststellung steht der durch Julius Caesar dargelegten, primär geographisch motivierten Auffassung, daß der Rhein die Grenze zwischen Gallien und Germanien bildet (De bello Gallico I 1,1-4), letztlich nicht entgegen. Wenngleich er in seinen "Commentarii de bello Gallico" noch auf verbliebene keltische Gruppen rechts des Rheins hinweist (De bello Gallico VI 24,1-3), scheint der Raum westlich des Inn und östlich von Odenwald und Schwarzwald allerdings schon am Vorabend bzw. spätestens zu Beginn des Gallischen Krieges weitgehend verlassen worden zu sein. Dafür spricht, von wenigen Ausnahmen, vor allem im hier nicht näher betrachteten Bereich nördlich des Main, abgesehen, der archäologisch nachweisbare Abbruch der bekannten Siedlungen und Gräberfelder bereits während der 1. Hälfte des 1. Jh. v.Chr. (Stufe Latène D1). Eine der Hauptursachen dieser Landflucht bildete offensichtlich der seit dem ausgehenden 2. Jh. v.Chr. anhaltenden Druck germanischer Stämme aus dem Elberaum. Als prägnantester Vorstoß ist in diesem Zusammenhang der literarisch überlieferte Landnahmeversuch unter Führung des Sueben Ariovist in den Jahren von etwa 72 bis 58 v.Chr. zu nennen, dessen Bevölkerungsverwerfungen letztlich zur Initialzündung des Gallischen Krieges wurden. An ihm sollen, sofern es sich nicht um eine jüngere Textinterpolation handelt, u.a. auch die Germanenstämme der Vangionen, Nemeter und Triboker beteiligt gewesen sein (De bello Gallico I 51,2), die sich, trotz der Niederlage Ariovists gegen die Römer bei Mühlhausen (Elsaß) im Jahre 58 v.Chr., offensichtlich dauerhaft am Oberrhein festsetzen konnten. Allerdings ist der genaue Verbleib dieser Stämme bis zum Zeitpunkt ihrer römisch kontrollierten Ansiedlung entlang des linken Oberrheinufers (vom Wormser Raum bis ins Elsaß) während des 1. Jh. n.Chr. unklar. Noch im frühen 1. Jh. n.Chr. sind Neuansiedlungen suebischer Gruppen, wahrscheinlich Abwanderer aus dem Gebiet des Marbodreiches in Böhmen, im Starkenburger Raum südlich des Main, am unteren Neckar und um Diersheim (Ortenaukreis / BW) belegt. Von einer großflächigen Wiederaufsiedlung der rechtsrheinischen Gebiete der späteren Provinz Obergermanien kann jedoch vor Etablierung der römischen Administration wohl keine Rede sein. Dies bestätigt letztlich auch eine Aussage des P. Cornelius Tacitus (Germania 29): "Nicht zu den Völkerschaften Germaniens möchte ich die Leute rechnen, die die Agri Decumates bebauen, wenn sie sich auch jenseits von Rhein und Donau angesiedelt haben; gallisches Gesindel und aus Not Verwegene eigneten sich den umstrittenen Boden an."
Keltische (rot) und germanische (blau) Stammesgebiete/-gruppen
zwischen Mittel- und Hochrhein um die Mitte des 1. Jh. v.Chr.
|
Keltische (rot) und germanische (blau) Stammesgebiete/-gruppen
zwischen Mittel- und Hochrhein im 1. Jh. n.Chr.
|
Anders liegen hingegen die Verhältnisse im linksrheinischen Obergermanien. Der Norden gehörte hier zum Gebiet des hinsichtlich seiner materiellen Kultur keltisch-gallischen Stammes der Treverer, dessen Siedlungsraum in den Ardennen, der Eifel und dem Hunsrück sich zu Zeiten des Gallischen Kriegs noch von der Maas bis an den Rhein erstreckte. Die Grenze zu dem sich südlich anschließenden, ebenfalls keltischen Stamm der Mediomatricer verlief vermutlich in Rheinhessen bzw. der Nordpfalz. Auch das Gebiet letzteren Stammes, mit einer Westausdehnung bis etwa Verdun, reichte im Osten ursprünglich wohl bis an den Rhein und grenzte nach Südosten bzw. Süden an das der Rauraker, Sequaner und Leucer. Die Etablierung des römischen Militärbezirks Germania superior führte zu Beginn der römischen Kaiserzeit schließlich zu einer Abtrennung der Rheinzone von den Kernterritorien der Treverer und Mediomatricer, die in leicht bereinigter Form als Civitates in der Provinz Gallia Belgica verblieben. Inwieweit diese Abtrennung eventuell bestehende Besiedlungsverhältnisse berücksichtigte, ist unklar. Während sich etwa im Mainzer Raum mit der Anwesenheit der Caeracaten und Aresacen, bei letzteren handelte es sich vielleicht um einen kleinen Teilstamm der Treverer, mögliche Siedlungskontinuitäten zwischen der vorrömischen Eisenzeit und der Kaiserzeit abzeichnen, bedeutet die planmäßig durchgeführte Ansiedlung der germanischen Vangionen, Nemeter und Triboker im ehemaligen Mediomatricergebiet zweifelsohne einen Bruch. Die Platzwahl könnte in letzterem Falle allerdings durch das Fehlen einer nennenswerten einheimischen Vorbevölkerung bedingt gewesen sein.
Spätkeltische bis frührömische Siedlung von Westheim
|
Vorrömischer Holzpfostenbau unter dem Haupthaus
der Villa rustica "Im Brasil" bei Mayen; Gesamtplan und Detailplan
|
Während an der zeitlichen Zuordnung des bei einer Altgrabung aufdeckten,
ungewöhnlichen Mayener Baubefundes in die Spätlatènezeit schon gelegentlich
Zweifel angemeldet wurden, entsprechen die Westheimer Gebäude, von denen
mindestens fünf innerhalb und eines außerhalb der Umwehrung beobachtete werden
konnten, mit ihren neun-, zwölf- und mehrpfostigen, rechteckigen Grundrissen
späteisenzeitlichen Baustrukturen, wie die z.B. aus dem Treverergebiet hinreichend
belegt sind. Nach Ausweis des Fundmaterials und der einphasigen Baubefunde
bestand die erst in der 2. Hälfte des 1. Jh. v.Chr. (Latène D2) angelegte
Siedlung in Westheim nicht sehr lange und wurde offenbar bereits in spätaugusteisch/frühtiberischer
Zeit wieder aufgelassen. Verbindungen zu einem um 70 n.Chr. auf dem Siedlungsareal
errichteten Kleingehöft lassen sich jedenfalls nicht konstruieren. Die Westheimer
Anlage mit ihrer, ausgehend vom Kleinfundmaterial, zweifelsfrei keltisch-gallischen
Bevölkerung liegt am Rande eines Gebietes, in dem, nach Ausweis von Grabfunden,
frühestens ab mittelaugusteischer Zeit auch mit einer verstärkten Anwesenheit
elbgermanischer Neusiedler gerechnet werden muß. Generell ist in der Pfalz
bzw. im Raum östlich der Blies während der späten Latènezeit ein starker
Besiedlungsrückgang zu verzeichnen, der erst ab der Zeitwende durch Zuzug
offenbar germanischer Gruppen kompensiert wurde. Nicht selten sind hier Befunde
mit elbgermanischen Material in unmittelbar Nähe oder gar im Bereich späterer
Villae rusticae anzutreffen, was auf mögliche Siedlungskontinuitäten hindeuten
könnte. Neben Bestattungen handelt es sich dabei gelegentlich auch um Siedlungsrelikte,
die sich allerdings, wie etwa im Falle einer um 20/30 n.Chr. gegründeten
Villa rustica in Neustadt-Mußbach (Kr. Neustadt a. d. Weinstraße / RLP),
in der Regel nur in vereinzelten Pfosten- und Abfallgruben manifestieren.
Rekonstruierbare Gebäudestrukturen fehlen bislang. Nördlich der Pfalz dünnen
dann die germanischen Elemente unter den Grab- und Siedlungsfunden zu Gunsten
einheimisch keltischer Einflüsse, die schon in Rheinhessen überwiegen, deutlich
aus. Entsprechend sind hier dann auch des öfteren späteisenzeitliche Aktivitäten
neben oder im Bereich von römischen Gutshofarealen feststellbar, ohne, daß Siedlungskontinuitäten
bislang zweifelfrei belegt werden konnten. Beispiele wie die oben erwähnte
Villa in Mayen (Kr. Mayen-Koblenz / RLP), deren Holzbauphase eventuell schon
in augusteische Zeit zurückreicht, oder der Guthof "Auf der Klosterheck" in
Andernach (Kr. Mayen-Koblenz / RLP), mit latènezeitlichen Siedlungsgruben
und ebenfalls Pfostenspuren einer hölzernen Anfangsphase, gehören immer noch
zu den besten Hinweisen.
Gegenüber dem linksrheinischen Obergermanien, stehen im rechtsrheinischen
Teil des Betrachtungsgebietes, wie bei der historischen Einleitung schon angesprochen,
Kontinuitäten von der keltischen Vorbesiedlung zur römischen Kaiserzeit, auf
Grund einer massiven Abwanderung der keltischen Bevölkerungsgruppen schon während
Stufe Latène D1, nicht zu erwarten. Lediglich am Hochrhein und im südlichen
Oberrheintal, wo u.a. offene Siedlungen wie Breisach-Hochstetten (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald
/ BW) zu Gunsten neuer, umwehrter Plätze, im vorliegenden Fall Breisach-Münsterberg,
aufgelassen wurden, zeichnet sich ein partielles Verweilen keltischer Gruppen
auf rechtsrheinischem Gebiet noch während der 2. Hälfte des 1. Jh. v.Chr. (Stufe
Latène D2) ab. Über das Aussehen ländlicher Gehöftanlagen dieses Zeitabschnitts
liegen aus dem betreffenden Gebiet allerdings keine ausreichenden Informationen
vor. Auch über die Bauten rechtsrheinischer, germanischer Neusiedler, deren
materielle Hinterlassenschaften, wie oben bereits ausgeführt, ab der 1. Hälfte
des 1. Jh. n.Chr. vor allem südlich des unteren Main, am unteren Neckar und
in der Ortenau greifbar werden, ist außer Gruben mit Siedlungsabfällen in der
Regel nichts bekannt. Dabei ist zumindest im unteren Neckargebiet, wo den Neckarsueben
(Suebi Nicretes) nach vollzogener römischer Okkupation ab dem 2. Jh. n.Chr.
eine eigenständige Civitas eingeräumt wurde, von gewissen Siedlungskontinuitäten
auszugehen.
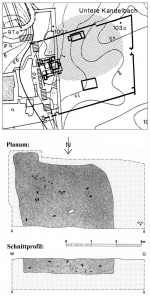 Als
ein mögliches Beispiel läßt sich etwa eine in claudischer Zeit gegründete
neckarsuebische Siedlung in der Gewanne "Ziegelscheuer" in Ladenburg
(Rhein-Neckar-Kr. / BW) anführen, die an Baubefunden immerhin noch die Reste
einiger Grubenhütten erbrachte. Nach Ausweis des Kleinfundmaterials existierte
sie zumindest wohl noch in Teilen, als man hier in der 1. Hälfte des 2. Jh.
n.Chr. eine Villa rustica anlegte. Ob und inwieweit sich die Besitzer oder
zumindest Bewirtschafter dieses Gutshofes allerdings aus der älteren Siedlung
rekrutierten, läßt sich letztlich nicht mehr beantworten.
Als
ein mögliches Beispiel läßt sich etwa eine in claudischer Zeit gegründete
neckarsuebische Siedlung in der Gewanne "Ziegelscheuer" in Ladenburg
(Rhein-Neckar-Kr. / BW) anführen, die an Baubefunden immerhin noch die Reste
einiger Grubenhütten erbrachte. Nach Ausweis des Kleinfundmaterials existierte
sie zumindest wohl noch in Teilen, als man hier in der 1. Hälfte des 2. Jh.
n.Chr. eine Villa rustica anlegte. Ob und inwieweit sich die Besitzer oder
zumindest Bewirtschafter dieses Gutshofes allerdings aus der älteren Siedlung
rekrutierten, läßt sich letztlich nicht mehr beantworten.
Neckarsuebische Siedlung im Gewann "Ziegelscheuer" in Ladenburg;
Gesamtausdehnung (gepunktet) im Bereich der römischen Villa und Beispielbefund
einer Grubenhütte
Phase III bis IV (nach Oelmann) des Haupthaus der
Villa rustica "Im Brasil"
|
Zahlreiche Holzpfostenstellungen entlang und parallel der Wände des hallenartigen Innenraumes, die F. Oelmann seinerzeit als Pfosten der Dachkonstruktion interpretierte, könnten eventuell ebenso Teile einer vorausgehenden Holzbauphase gebildet haben. Eine solche nimmt auch der Ausgräber an, ohne ihr jedoch wirklich aussagekräftige Befunde zuordnen zu können. Der ergänzte Pfostenplan des Innenraumes ist hingegen gut mit den einfachen, rechteckigen Grundrissen hölzerner Wohngebäude auf Gutshöfen im südlichen Niedergermanien vergleichbar. Die entsprechenden Häuser lassen sich dort als eine möglicherweise nordgallisch beeinflußte, frühkaiserzeitliche Weiterentwicklung der lokalen, in ihrer Form stark an den Mittelgebirgsraum angelehnten Holzpfostenbauten der späten Eisenzeit auffassen. Kennzeichen ist auch hier der hallenartige Innenraum, der bei der Mayener Villa auch noch die erste Steinbauphase prägte. Ungeachtet der diskutablen Verbindungen zwischen dem Villengebäude und einem von ihm überlagerten eisenzeitlichen Hausgrundriß, könnte also die Villa in Mayen sowohl in ihrer Holzbauphase als auch noch dem ersten Steinbau traditionell gallische Raumkonzepte weiter fortgeführt haben.
 Ihrer
frühen Steinbauphase ähnelnde ländliche Siedlungsgebäude zu Wohn- und Wirtschaftszwecken
konnten auch anderenorts im nördlichen Obergermanien, so z.B. in Bolanden (Donnersberg-Kr.
/ RLP), Monreal (Kr. Mayen-Koblenz / RLP) oder Enkenbach-Alsenborn (Kr. Kaiserslautern
/ RLP), aufgedeckt werden. Die in den genannten Fällen frühestens im 2. Jh.
n.Chr. oder später angelegten Bauten ohne nachgewiesene Nebengebäude werden
in der Regel als einfachste ländliche Siedlungsform bzw. Kleinbauernhäuser
interpretiert. Inwieweit letzteres zutrifft und sie darüber hinaus eventuell
als Belege für die Fortsetzung eines traditionellen Raumkonzeptes noch bis
in die späte Kaiserzeit anzusehen sind, ist an vorliegender Stelle nicht zu
entscheiden.
Ihrer
frühen Steinbauphase ähnelnde ländliche Siedlungsgebäude zu Wohn- und Wirtschaftszwecken
konnten auch anderenorts im nördlichen Obergermanien, so z.B. in Bolanden (Donnersberg-Kr.
/ RLP), Monreal (Kr. Mayen-Koblenz / RLP) oder Enkenbach-Alsenborn (Kr. Kaiserslautern
/ RLP), aufgedeckt werden. Die in den genannten Fällen frühestens im 2. Jh.
n.Chr. oder später angelegten Bauten ohne nachgewiesene Nebengebäude werden
in der Regel als einfachste ländliche Siedlungsform bzw. Kleinbauernhäuser
interpretiert. Inwieweit letzteres zutrifft und sie darüber hinaus eventuell
als Belege für die Fortsetzung eines traditionellen Raumkonzeptes noch bis
in die späte Kaiserzeit anzusehen sind, ist an vorliegender Stelle nicht zu
entscheiden.
Einfache Wohn-/Wirtschaftsbauten aus Bolanden, Enkenbach-Alsenborn und Monreal; Grundrißpläne
Gehöfte/Gutshöfe im 1. Jh. n.Chr.
|
Im Gegensatz zur linken Rheinseite ist in weiten Teilen des rechtsrheinischen
Gebietes wahrend der 1. Hälfte des 1. Jh. n.Chr. noch kein römischer Siedlungseinfluß spürbar.
Befunde wie etwa die der in claudischer Zeit entstandenen, neckarsuebischen
Siedlung von Ladenburg-"Ziegelscheuer" können, trotz diskutablen
Bevölkerungskontinuitäten, sicherlich nicht als Gründungsphase der hier in
späterer Zeit angelegten römischen Villae rusticae aufgefaßt werden. Ein abweichendes
Bild scheint sich lediglich am südlichen Oberrhein und am Hochrhein abzuzeichnen,
wo es bereits in den 20er/30er Jahren und in claudischer Zeit zu wirklichen
Gutshofgründungen auf dem rechten Rheinufer kommt. Es dürfte sich wohl kaum
um einen Zufall handeln, daß es sich bei der Region ausgerechnet um jenen rechtsrheinischen
Streifen handelt, in dem sich keltische Bevölkerungsteile auch noch während
der 2. Hälfte des 1. Jh. v.Chr. (Stufe Latène D2) behaupten konnten. Die vorauszusetzende
enge Anbindung an ihre linksrheinischen Nachbarn mag, einhergehend mit der
Etablierung einer dauerhaften römischen Präsenz am Rhein, die frühe Romanisierung
dieses Gebietes, das nun im Vorfeld städtischer und militärischer Zentren lag,
beflügelt haben.
Dementsprechend ergeben sich hier auch im weiteren Verlauf des 1. Jh. n.Chr.
Parallelen zwischen der ländlichen Besiedlungsentwicklung diesseits und jenseits
des Rheines. So schlägt sich etwa die starke Gründungswelle, die in flavischer
Zeit vor allem in der Nordschweiz und dort besonders im Umfeld des Legionslagers
von Windisch (Kt. Aargau / Schweiz) archäologisch gut zu fassen ist, ebenso
in der Errichtung zahlreicher neuer Villae rusticae entlang des rechten Hochrheinufers
nieder. Die in dieser Phase in den Gutshöfen zu beiden Seiten des Flusses verbauten
Ziegel mit militärischen Stempelmarken der Windischer Garnison könnten eventuell
gar im Sinne eines staatlich geförderten Besiedlungsprogramms zu interpretieren
sein (näheres dazu siehe unter: Villae rusticae im Südteil des Provinz Germania
superior), das offensichtlich beide Rheinseiten einbezog.
Gehöfte/Gutshöfe um 100 n. Chr. bis 1. Hälfte 2.
Jh. n.Chr..
|
In der Zeit um 100 n.Chr. lassen sich nachfolgend auch erste Villen am Oberlauf
von Neckar und Donau feststellen. Mit einer gewissen Zeitverzögerung mag sich
hierin vielleicht die relativ frühe Erschließung des Gebietes mit dem Municipium
Arae Flaviae (Gründung um 72 n.Chr.), dem heutigen Rottweil (Kr. Rottweil /
BW), als Zentrum sowie Straßenanbindungen nach Windisch (Kt. Aargau / Schweiz)
und schon ab 74 n.Chr. auch über das Kinzigtal nach Straßburg (Dép. Bas-Rhin
/ F) ausgewirkt haben.
Demgegenüber setzt die ländliche Besiedlung im mittleren und unteren Neckergebiet
bzw. rechts des mittleren Oberrhein, sieht man von wenigen unsicheren Einzelfällen
ab, offenbar nicht vor frühhadrianischer Zeit ein. Einen besonderen Besiedlungsschub
erfährt das mittlere Neckarland gar erst kurz vor bzw. nach der Vorverlegung
des obergermanischen Limes vom Neckar auf die Linie Miltenberg-Lorch um 150
n.Chr.. Inwieweit bis dato möglicherweise unklare Rechts- und Besitzverhältnisse
sowie nicht zuletzt auch das Fehlen einer geeigneten Bevölkerungsgrundlage
eine Aufsiedlung mit Gutshöfen verzögerten, ist diskutabel.
Gehöfte/Gutshöfe in der Mitte/ 2. Hälfte des 2. Jh.
n.Chr. .
|
Sofern noch anhand weniger Reste, die in der Regel keinen klaren Grundriß mehr ergeben, feststellbar, geht zumindest einem Großteil der steinernen Guthöfe sowohl im linksrheinischen als auch rechtsrheinischen Betrachtungsgebiet eine Holzbauphase voran. Erste steinerne Um- bzw. Neubauten erfolgten auch links des Rheines offenbar meist nicht vor dem späten 1. Jh. n.Chr.. Wie etwa Beispiele aus Reipoltskirchen (Kr. Kusel / RLP) oder vom "Annaberg" in Bad Dürkheim (Kr. Bad Dürkheim-Weinstraße / RLP) zeigen, wurden selbst noch in dieser Zeit bzw. an der Wende zum 2. Jh. n.Chr. sowohl kleine Gehöfte als auch größere Villen gelegentlich zunächst als Holzgebäude errichtet. Diese Beobachtung läßt sich bei den rechtsrheinischen Gutshofanlagen zumindest während der 1. Hälfte des 2. Jh. n. Chr. weiter fortführen. Soweit näher ermittelbar, erfolgte der steinerne Ausbau hier meist erst ab der Mitte des 2. Jh. n.Chr. oder, wie z.B. im Falle der erst um 150 n.Chr. bzw. kurz darauf im mittleren Neckarraum gegründeten Villen von Bietigheim-Bissingen (Kr. Ludwigsburg / BW) und Weinsberg (Kr. Heilbronn / BW), gar frühestens in der fortgeschrittenen zweiten Jahrhunderthälfte.
Holzbauphase (1. Hälfte 2. Jh. n.Chr.) der Villa
rustica von Bondorf
|
Eine vergleichbare Kontinuität desselben Anlagenkonzeptes zwischen der älteren und der jüngeren Bauphase zeigt auch die Villa rustica von Walldorf (Rhein-Neckar-Kr. / BW), deren nachgewiesene Holzgebäude in ihren Baufluchten allerdings von den jüngeren Steinbauten abweichen. Das in Holzfachwerktechnik errichtete Haupthaus (Bau 16) mit seinem um einen zentralen Raum oder Hof angeordneten Zimmern und einem risalitartigen Anbau folgt dem Konzept des sogenannten Zentralhof- bzw. Zentralhallenbaus, das gelegentlich auch bei Steingebäuden vorkommt. Böden mit Kalkmörtelestrich und Reste polychromer Wand- und Deckenmalereien deuten auf eine gehobene Ausstattung hin.
Villa rustica von Walldorf;
Gesamtplan der Holz- und Steinbauphase |
Villa rustica von Walldorf;
Wandmalereien aus dem Haupthaus |
Von den zahlreichen Nebengebäuden im Gutshofareal sind zumindest ein als Speicher oder Magazin gedeuteter, langrechteckiger Fachwerkbau (Bau 4) mit Pfostengründungen im Bereich der Außenwände sowie einige kleinere, mitunter wohl nur in Teilen bekannte Schwellbalken- und/oder Pfostenbauten anhand ihrer Ausrichtung der Holzbauphase zuweisbar. Umgeben war das Areal offenbar von einem Zaun oder einer Palisade, deren mögliches Gräbchen anscheinend bereits parallel zu nordwestlichen Hofmauer der Steinbauphase verlief.
Das beste Bild über die Anlage und Gliederung der Villae rusticae vermitteln
immer noch deren Steinbauphasen. Generell steht jedoch die Anzahl von mehreren
tausend auf Basis von Prospektionen postulierter und auf Verbreitungskarten
auch publizierter Gutshöfe im Betrachtungsgebiet in einem krassen Mißverhältnis
zu den durch Baubefunde zweifelsfrei identifizierten Villae rusticae. In
letzterem Fall haben die Grabungen zudem selten mehr als einzelne Gebäude
(oft Haupthaus und/oder Bad) oder auch nur Gebäudeteile angeschnitten. Die
Anzahl großflächig bis annähernd vollständig erforschter Landgüter beläuft
sich, soweit auf literarischer Basis greifbar, im rechtsrheinischen Raum
auf maximal ein knappes Dutzend Stellen, während der linksrheinische Bereich
gerade einmal die Hälfte dieser Zahl erreicht. Entsprechend eingeschränkt
sind dann auch die derzeitigen Aussagemöglichkeiten zur Gesamtstruktur der
Anlagen.
Immerhin lassen sich die beiden in den Nordwestprovinzen üblichen Grundmuster
in Bezug auf die Binnengliederung der Höfe auch im Arbeitsgebiet nachweisen.
Zu unterscheiden sind:
a) Streuhofanlagen.
b) Axialanlagen.
Bei Streuhofanlagen verteilen sich das Haupthaus und die Nebengebäude derart über
das Hofareal, daß oft weder ein Bezug ihrer Baufluchen aufeinander noch ein übergeordnetes,
axiales Binnengliederungskonzept oder eine klare Trennung von Wohn- und Wirtschaftsbereich
(Pars urbana und Pars rustica) erkennbar ist.
Von nur wenige Ausnahmen abgesehen, folgen bislang fast alle näher beurteilbaren
Gutshöfe im hier interessierenden Raum mehr oder minder dem Streuhofkonzept,
auch wenn die gelegentliche Orientierung der Nebengebäude am Verlauf der Hofeinfriedung
mitunter schon einen ansatzweise symmetrischen Eindruck bewirkt. Hinsichtlich
ihres Untersuchungsstandes einigermaßen aussagekräftige Beispiele finden sich
links des Rheines etwa in:
- Bad Dürkheim-Ungstein (Kr. Bad Dürkheim-Weinstraße / RLP).
- Koblenz (Stadt Koblenz / RLP); Koblenzer-Stadtwald am Remstecken.
- Mayen (Kr. Mayen-Koblenz).
- Thallichtenberg (Kr. Kusel / RLP).
- Wachenheim (Kr. Bad Dürkheim-Weinstraße / RLP).
- Weiler bei Bingen (Kr. Mainz-Bingen / RLP).
- Weitersbach (Kr. Birkenfeld / RLP).
- Winningen (Kr. Mayen-Koblenz).
Am "Weilberg" in Bad Dürkheim-Ungstein
|
Am "Remstecken" im Stadtwald von Koblenz
|
Wachenheim
|
Weiler bei Bingen
|
An prägnanten rechtsrheinischen Streuhofanlagen lassen sich u.a. anzuführen:
- Bietigheim-Bissingen (Kr. Ludwigsburg / BW).
- Bondorf (Kr. Böblingen / BW).
- Bruchsal-Obergrombach (Kr. Karlsruhe / BW).
- Engen-Bargen (Kr. Konstanz / BW).
- Ettlingen (Kr. Karlsruhe / BW).
- Gemmrigheim (Kr. Ludwigsburg / BW).
- Hechingen-Stein (Zollernalbkreis / BW).
- Kirchheim am Neckar (Kr. Ludwigsburg / BW).
- Ladenburg (Rhein-Neckar-Kr. / BW).
- Lauffen am Neckar (Kr. Heilbronn / BW).
- Ludwigsburg-Hoheneck (Kr. Ludwigsburg / BW).
- Mühlacker-Enzberg (Enzkreis / BW).
- Oberndorf-Bochingen am Neckar (Kr. Rottweil / BW).
- Pforzheim-Hagenschieß (Stadt Pforzheim / BW).
- Rottenburg am Neckar (Kr. Tübingen / BW).
- Sachsenheim-Großsachsenheim (Kr. Ludwigsburg / BW).
- Tengen-Büßlingen (Kr. Konstanz / BW).
- Vaihingen-Enzweihingen an der Enz (Kr. Ludwigsburg / BW).
- Walldorf (Rhein-Neckar-Kr. / BW).
Bondorf
|
Ludwigsburg-Hoheneck
|
Rottenburg am Neckar
|
Tengen-Büßlingen
|
Die Gutshöfe in Streubauweise decken dabei das gesamte regionale Größenspektrum ab, sind jedoch im überregionalen Vergleich, besonders mit gallischen Landgütern oder auch solchen des südlichen Obergermanien, überwiegend als Anlagen kleiner bis mittlerer Größe einzustufen.
Gegenüber der Streubauweise sind Axialanlagen in der Regel auf die durch
Mauern oder Gebäuderiegel strikt vom Wirtschaftsteil (Pars rustica) isolierte
Pars urbana (Wohnteil) bezogen, in deren Zentrum sich das Haupthaus erhebt.
Auf dessen repräsentative Fassade sind in Idealfall die Baufluchten der meisten
Nebengebäude, Hofmauern und Hauptwirtschaftswege ausgerichtet. Dadurch macht
sich in der Anlage der Pars rustica eine gewisse axiale Bausymmetrie bemerkbar,
was jedoch nicht bedeutet, daß jedes Gebäude zwangläufig ein spiegelbildliches
Pendant besitzen muß. Je nach Anordnung der Pars urbana, ob an der Schmal-
oder Längsseite des umfriedeten Wirtschaftshofes, unterscheidet man zwischen
längs- und queraxial angelegten Gutshöfen.
Im Betrachtungsgebiet spielt das Schema der Axialvilla praktisch keine Rolle.
Während queraxiale Anlagen vollständig fehlen, sind längsaxiale bislang lediglich
in zwei Fällen greifbar. Von diesen ist das linksrheinisch gelegenen Landgut
von Thür (Kr. Mayen-Koblenz / RLP) zudem leider nur auf Basis von Luftbildern
zu beurteilen.
| Axialhofanlage von Thür; Gesamtplan nach Luftbild |
Der Umstand, daß beim Heitersheimer Gutshof das Haupthaus mit seinem Baukörper selbst als Trennelement zwischen der Pars rustica und der Pars urbana fungierte, anstatt, zumindest mit seinem Haupttrakt, bereits weit innerhalb des separierten Hofteils zu liegen, setzt ihn dann allerdings auch etwas gegen die meisten der südlichen Vergleichsbeispiele ab. Eine ähnliche Trennfunktion zwischen dem Wirtschaftsteil und einer unbebauten, vermutlich meist als Garten gestalteten Fläche übernehmen mitunter ebenso auch die Haupthäuser auf Höfen des Streuschemas. Im Betrachtungsraum wären als Belege u.a. etwa Villae rusticae in Weiler bei Bingen (Kr. Mainz-Bingen / RLP) oder Ettlingen (Kr. Karlsruhe / BW) anzuführen.
Axialhofanlage von Heitersheim
|
Streuhofanlage am Hedwigshof bei Ettlingen
|
Trotz des offensichtlich deutlichen Übergewichtes der Streuhofanlagen, präsentiert
sich der innerhalb des Arbeitsgebietes greifbare Gutshofbestand keinesfalls
uniform. So gibt es enorme Varianzen in der Größe und Bebauung der Höfe.
An unterster Stelle stehen möglicherweise Kleinst- oder Kompaktgehöfte, die
durch ihre Beschränkung auf einen einzigen Gebäudekomplex zu Wohn- und Wirtschaftzwecken,
allenfalls ergänzt durch Schuppen oder andere Leichtbauten, welche sich in
der Regel dem archäologischen Zugriff entziehen, letztlich keinem der vorausgehend
dargelegten Grundschemata zugeordnet werden können. Die Identifizierung und
damit verbunden auch der Nachweis ihrer Existenz ist in der Forschung allerdings
nicht ganz unumstritten.
Bolanden
|
Monreal
|
Enkenbach-Alsenborn
|
Kehl-Auenheim
|
So wäre für die einfachen, rechteckigen Steingebäude, wie sie etwa in Bolanden
(Donnersberg-Kr. / RLP), Monreal (Kr. Mayen-Koblenz / RLP) oder Enkenbach-Alsenborn
(Kr. Kaiserslautern / RLP) ergraben wurden, anhand der Bauform auch eine Einstufung
als Nebengebäude einer größeren Anlage denkbar. Gleiches gilt für einen hölzernen
Schwellbalkenbau gleicher Formgebung in Kehl-Auenheim (Ortenaukr. / BW), in
dessen Umgebung sogar ein weiteres Balkengräbchen, Gruben und Pfostenlöcher
festgestellt werden konnten. Die Klassifizierung der einfachen Rechteckbauten
hängt also im wesentlichen vom Nachweis oder Fehlen ihnen benachbarter Gebäude
ab.
Eine etwas andere Form möglicher kleiner Kompakthöfe repräsentieren demgegenüber
Bauten wie z.B. in Reipoltskirchen (Kr. Kusel / RLP), Lörrach-Brombach (Stadt
Lörrach / BW) oder Wurmlingen (Kr. Tuttlingen / BW), bei denen sich einige
Wohn- und Wirtschafträume an zwei oder drei Seiten eines befahrbaren Innenhofes
aufreihen.
Wohn-/Wirtschaftsgebäude in Reipoltskirchen
|
Wohn-/Wirtschaftsgebäude in Lörrach-Brombach
|
Gutshof in Wurmlingen
|
Ob derartige Gebäude zwangsläufig Nebengebäude besaßen ist unklar. Während in Reipoltskirchen lediglich prospektierte Hinweise auf ein solches vorliegen, wurden beim Wurmlinger Gehöft noch im Verlauf der Holzbauphase ein separates, steinernes Badegebäude und während der anschließenden Steinbauphase ein weiteres Nebengebäude errichtet. Trotz des fehlenden Nachweises einer Gesamteinfriedung läßt sich die Wurmlinger Gebäudegruppe bereits als kleine Streuhofanlage einstufen. Dennoch besteht über die Bedeutung entsprechender Landsiedlungen in der Forschung keine Einigkeit. Vor allem das kompakte Zentralgebäude mit seinem befahrbaren Hof hat bei straßennahen Anlagen die Vorstellung beflügelt, daß es sich weniger um landwirtschaftliche Betriebe, als vielmehr um Straßenstationen gehandelt haben könnte, die teils staatsseitig angelegt wurden.
Gebäudekomplex in Hohberg-Niederschopfheim
|
Für letztere These wird dabei gerne ein Baukomplex nahe der römischen Rheinstraße
in Hohberg-Niederschopfheim (Ortenaukr. / BW) angeführt, in dessen erster Bauphase
gestempelte Ziegel der 21. Legion Verwendung fanden. Wenngleich zudem eine
scheinbar regelmäßige Zimmerflucht während der zweiten Bauphase eine Interpretation
als Mansio nicht ausschließt, bleibt die wirtschaftliche Grundnutzung der Anlage
letztlich dennoch unklar. Generell wäre in diesem Zusammenhang natürlich zu überlegen,
inwieweit primär landwirtschaftliche Betriebe eine verkehrsgeographisch günstige
Lage genutzt haben könnten, um aus der Bewirtung Reisender einen Nebenverdienst
zu erzielen.
Unstrittige Gutshofanlagen mit Haupthaus und Nebengebäude innerhalb einer Einfriedung
sind schließlich im Arbeitsgebiet in der Regel mit Hofflächen von knapp unter
1 ha bis maximal etwas über 7 ha Größe vertreten. Dabei scheinen die tendenziell
größten Anlagen, wie etwa ein weitgehend erforschtes Anwesen mit rund 7,5 ha
in Bad Dürkheim-Ungstein (Bad Dürkheim-Weinstraße / RLP), eher im linksrheinischen
Gebiet oder zumindest in Rheinnähe gelegen zu haben. Unter den rechtsrheinischen
Villae rusticae liegt die Obergrenze derzeit bei 5,5 bis 6 ha. Sie wird allerdings
nur in von wenigen Höfen, so z.B. in Hechingen-Stein (Zollernalbkreis / BW),
Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW) oder Tengen-Büßlingen (Kr.
Konstanz / BW) erreicht. Den Normalfall im Limesgebiet bilden demgegenüber
Gehöfte in einer Größenordnung bis maximal etwas über 3 ha. Über die Zahl der
ständigen Bewohner auf den Landgütern kann man nur spekulieren. Während bei
kleinen Villen, wie etwa einer nur 0,75 ha großen Anlage mit Haupthaus und
drei Wirtschaftsgebäuden in Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kr. / BW), an eine
Bewirtschaftung durch eine Familie zu denken ist, lassen zu Wohnzwecken genutzte
Nebengebäude, wie z.B. in den rund 1 ha großen Villen von Lauffen (Kr. Heilbronn
/ BW) oder Pforzheim-Hagenschieß (Stadt Pforzheim / BW), schon auf die Anwesenheit
von Knechten, abhängigen Familien oder zumindest Tagelöhnern schließen.
|
Villa rustica von Kernen-Rommelshausen
|
|
Villa rustica von Lauffen a. N.
|
Große Speicherbauten und umfangreiche Einrichtungen zur Getreideverarbeitung, wie sie etwa aus dem rund 4 ha großen Areal einem gelegentlich auch als kaiserliche Domäne gedeuteten Besitz in Walldorf (Rhein-Neckar-Kr. / BW) bekannt sind, setzten dann bereits einen recht hohen Personalstand voraus, auch wenn im genannten Fall bislang keine adäquaten Unterbringungsmöglichkeiten nachgewiesen werden konnten. Zur Bewirtschaftung eines der rund 7,5 ha großen Villa rustica in Bad Dürkheim-Ungstein (Bad Dürkheim-Weinstraße / RLP) vergleichbaren Landgutes kann, auch angesichts der vorhanden Gebäudekapazitäten, schließlich durchaus mit einer Anwesenheit von über hundert Personen gerechnet werden.
Villa rustica von Walldorf
|
Guthof in Bad Dürkheim-Ungstein
|
Natürlich sind entsprechende Kalkulationen auch in hohem Grade von den durch die einzelnen Villen bewirtschafteten Ländereien abhängig. Da sich im Arbeitsgebiet keinerlei Spuren der vorauszusetzenden römischen Limitationen mehr fassen lassen, sind lediglich vage Schätzungen auf Basis des derzeitigen Fundortbestandes möglich. Sie reichen von Wirtschafsflächen zwischen 60 und 120 ha im mittleren Neckargebiet oder zwischen 50 und 125 ha im Hinterland von Speyer / RLP bis über 200 ha im Alsenztal (Nordpfälzer Bergland). Dabei dürften die extremen Schwankungen der Flachengrößen zumindest teilweise den unterschiedlichen Bodengüten und damit verbunden auch möglicherweise verschiedenen landwirtschaftlichen Nutzungen Rechnung tragen.
Die besterforschten Bestandteile der Villae rusticae bilden das in der Regel
als Haupt- oder Herrenhaus bezeichnete Wohnhaus des Gutsbesitzers oder -pächters
und die ihm direkt angeschlossenen oder aber in einem separaten Gebäude untergebrachten
Baderäume. Hierfür ist zum Teil der aus ihrer massiveren Bauweise resultierende
größere Schuttanfall verantwortlich, der sie einerseits von den meist kleineren
Trummerstellen ihrer Nebengebäude unterscheidet und anderseits auch eine leichtere
Lokalisierung bei archäologischen Prospektionen ermöglicht. Sieht von man den überwiegend
nur fragmentarischen Resten hölzerner Vorgängerbauten ab, stellen die Grundrisse
der jüngeren Steingebäude mitunter das Produkt verschiedener Um- und Ausbauten
dar, die im linkrheinischen Gebiet zwischen dem späten 1. Jh. und dem 4. Jh.
n.Chr. sowie bei den rechtrheinischen Villen meist ab dem mittleren 2. Jh.
bis um die Mitte des 3. Jh. n.Chr. stattfanden. In der Regel haben sie die
ursprünglich Grundgrißkonzeption jedoch nicht verunklart. Als Grundtypen lassen
sich die Form der "Zentralhofanlage" und der "Portikusvilla" unterscheiden.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, daß Gebäude letzterer Form durch die
sekundäre Vorblendung einer Portikusfassade mitunter aus Häusern des "Zentralhof-Typs" hervorgegangen
sind. Der anderenorts gelegentlich noch zu beobachtende "basilikale" Bautyp,
bei dem der Kernbau einem dreischiffigen Raumgliederungskonzept folgt, scheint
im Betrachtungsraum bislang zu fehlen.
Unter dem Begriff des "Zentralhof-Typs" sind Bauten summiert, bei
denen sich die Räumlichkeiten in streifenartigen Gebäudeflügeln um einen zentralen
Innenhof gruppieren. Alternativ wird für sie mitunter auch der Begriff der "Peristylvilla" benutzt,
zumal wohl gelegentlich mit umlaufenden Vordächern im Hofbereich gerechnet
werden muß. Daneben ist es eine alte Streitfrage, ob es sich wirklich immer
um offene Höfe oder nicht teilweise auch zentrale Hallen gehandelt hat. Abhängig
von der Größe und Konzeption des Hauses sowie vom jeweiligen Befund, der in
manchen Fällen etwa in einem groben Hofpflaster und in anderen in einer flächigen
Dachziegelschuttlage besteht, wird man letztlich wohl beide Alternativen berücksichtigen
müssen. Im linksrheinischen Betrachtungsraum gehören zum Zentralhof-Typ eventuell
Hauptgebäude von Gutshöfen in:
- Bad Kreuznach (Kr. Bad Kreuznach / RLP); Fundstelle "Hüffelsheimer Str.".
- Medard (Kr. Kusel / RLP)
Im rechtsrheinischen Raum:
- Bad Rappenau-Zimmerhof (Kr. Heilbronn / BW).
- Gundelsheim-Bachenau (Kr. Heilbronn / BW).
- Hallau (Kt. Schaffhausen / Schweiz).
- Hohberg-Niederschopfheim (Ortenaukr. / BW)
- Kirchheim am Neckar (Kr. Ludwigsburg / BW).
- Schleitheim (Kt. Schaffhausen / Schweiz); Fundstelle "Brüel"
- Walldorf (Rhein-Neckar-Kr. / BW); Holzbauphase.
Villa rustica von Medard
|
Haupthaus des Gutshofes von Bad Rappenau-Zimmerhof
|
Gebäudekomplex in Hohberg-Niederschopfheim
|
Wohngebäude der Villa rustica an der Fundstelle "Brüel" in
Schleitheim
|
Darüber hinaus steht dem vorliegenden Bautyp auch eine Gruppe von Gebäuden
nahe, deren Wohnräumlichkeiten sich nur an zwei bis drei Seiten um einen offenen,
teilweise befahrbaren Innenhof gruppieren, dessen andere Seiten durch Mauern
mit meist hofseitig angebauten offen Unterständen bzw. leicht konstruierten
Wirtschaftsräumen umschlossen werden. Neben Reipoltskirchen (Kr. Kusel / RLP)
als linksrheinischem Beispiel, finden sich rechtsrheinische Belege in:
- Blumberg-Achdorf-Überachen (Schwarzwald-Baar-Kr. / BW).
- Bietigheim-Bissingen (Kr. Ludwigsburg / BW).
- Lörrach-Brombach (Stadt Lörrach / BW).
- Schleitheim (Kt. Schaffhausen / Schweiz); Fundstelle "Lendenberg".
- Tengen-Büßlingen (Kr. Konstanz / BW).
- Wurmlingen (Kr. Tuttlingen / BW).
Unter Berücksichtigung von Haupt- und Nebengebäuden entsprechender Konstruktion,
zeichnet sich eine gewisse Häufung solcher Bauten vor allem im Bereich von
oberer Donau und Hochrhein sowie im nordwestlichen Raetien ab (siehe dazu
Trumm 2002, 152ff.).
Haupthaus und Nebengebäude eines Gutshofes in Blumberg-Achdorf-Überachen
|
Haupthaus(?)/Wohngebäude einer Villa rustica Bietigheim-Bissingen
|
Wohngebäude der Villa rustica an der Fundstelle "Lendenberg" in
SchleitheimNiederschopfheim
|
Haupthaus der Villa rustica von Tengen-Büßlingen
|
Die sowohl im links- als auch im rechtrheinischen Arbeitsgebiet am häufigsten
vertretene Haupthausform bildet schließlich die sogenannte "Portikusvilla",
deren Räumlichkeiten in erster Linie über eine der Hauptfront des Gebäudes
vorgelagerte, repräsentative Portikus erschlossen werden. Unter dieser ist
häufig auch der in den Villen des Betrachtungsraumes fast ausnahmslos vorhandene
Kellerraum anzutreffen, da hier, angesichts ihrer meist talseitigen Lage, der
für letzteren notwendige Aushub am geringsten ausfiel. Bei stärkeren Hanglagen
erfolgte der Zugang zur Portikus mitunter über eine zentrale Freitreppe. Weitreichende
Gliederungsversuche des vorliegende Villentyps, die im folgenden nicht näher
ausgeführt werden sollen, beziehen sich schließlich darauf, ob sich die Räumlichkeiten
hinter der Portikus in einer Reihe oder um einen zentralen Raum bzw. Hof gruppieren
(siehe z.B. zuletzt Heimberg 2002/2003, 91ff.). Unabhängig von den zum Teil
nur schwer in ein Schema zu pressenden Raumkonzepten, lassen sich allerdings
auch in der Ausführung der Portikusfassade schon verschiedene Bauvarianten
beobachten.
In der einfachsten Form verläuft vor der Hauptfront des Gebudes ein durchgängiger,
gerader Säulengang, wie er, über einer Kryptoportikus gelegen, etwa bei der
palastartigen Villa an der "Hüffelsheimer Str." in Bad Kreuznach
(Kr. Bad Kreuznach / RLP) rekonstruiert werden kann. Im Gesamtkonzept letzterer
Anlage spielt
die Portikus allerdings nur eine untergeordnete Rolle, während das dominierende
Großperistyl in ihrem Zentrum eine Klassifizierung des Gebäude als Peristylvilla
bzw. Zentralhofanlage nahelegt.
Haupthaus des Landgutes an der Hüffelsheimer Straße
in Bad Kreuznach
|
Haupthaus der Villa rustica "Ziegelscheuer" in
Ladenburg;
|
Villa rustica von Hirschberg-Großsachsen
|
Sonstige Anlagen mit entsprechendem Säulengang sind im Betrachtungsraum nur
schwer zu finden. Immerhin scheinen etwa Haupthäuser von Villen in Ladenburg
(Rhein-Neckar-Kr. / BW) und eventuell auch Hirschberg-Großsachsen (Rhein-Neckar-Kreis
/ BW), im ersten Fall während der anfänglichen Holzbauphase und im zweiten
zur Zeit der ersten Steinbauphase, noch über eine solch einfache Portikusfront
verfügt zu haben.
Die ansonsten vorherrschende Bauform stellt die sogenannte "Portikusvilla
mit Eckrisaliten" dar, bei der der Säulengang durch zwei an den Gebäudeecken
risalitartig vorspringende Räumlichkeiten begrenzt wird. Bauten mit nur einem
Eckrisalit, wie beispielsweise in der älteren Phase einer Villa in Alzey-Dautenheim
(Kr. Alzey-Worms / RLP), sind hingegen selten.
|
Villa rustica von Bruchmühlbach-Miesau
|
|
Gutshof "In den Kirschkläuern" bei Alzey-Dautenheim
|
Villa rustica in Katzenbach
|
Das Vorkommen repräsentativer Portikus-Risalitfassaden ist keinesfalls an
eine bestimmte Gebäudegröße gebunden. Die Frontmaße der Bauten reichen von
rund 20 bis 65 m, bewegen sich mehrheitlich jedoch bei Breiten von deutlich
unter 40 m. Wie etwa der lediglich punktfundamentierte Fachwerkbau hinter der
steinernen Fassade einer kleinen Villa in Bruchmühlbach-Miesau (Kr. Kaiserslautern
/ RLP) oder der nur rund 24 m bereite Kernbau hinter einer 65 m langen Portikus-Risalitfront
in Katzenbach (Donnersberg-Kr. / RLP) eindrucksvoll demonstrieren, ist die
aufwendig gestaltete Vorderfront dabei mitunter nur Kulisse. Weitere prägnante
Beispiele des vorliegenden Fassadentyps findet man links des Rheins u.a. in:
- Alzey-Dautenheim (Kr. Alzey-Worms / RLP); jüngere Phase.
- Andernach (Kr. Mayen-Koblenz / RLP).
- Bad Kreuznach (Kr. Bad Kreuznach / RLP); Neubaugebiet Stadtrand.
- Herschweiler-Pettersheim (Kr. Kusel (RLP).
- Mayen (Kr. Mayen-Koblenz / RLP).
- Neustadt-Lachen-Speyerdorf (Kr. Neustadt a. d. Weinstraße / RLP).
- Rothselberg (Kr. Kusel / RLP).
- Thallichtenberg (Kr. Kusel / RLP).
- Warmsroth-Walderbach (Kr. Bad Kreuznach / RLP).
- Weiler bei Bingen (Kr. Mainz-Bingen / RLP).
Villa rustica von Neustadt-Lachen-Speyerdorf
|
Villa rustica in Rothselberg
|
Villa rustica in Thallichtenberg
|
Des weiteren sind im rechtsrheinischen Betrachtungsraum u.a. zu nennen:
- Bad Rappenau-Babstadt (Kr. Heilbronn / BW).
- Beringen (Kt. Schaffhausen / Schweiz).
- Bondorf (Kr. Böblingen / BW).
- Brigachtal-Überauchen (Schwarzwald-Baar-Kr. / BW).
- Eigeltingen-Eckartsbrunn (Kr. Konstanz / BW).
- Engen-Bargen (Kr. Konstanz / BW).
- Ettlingen (Kr. Karlsruhe / BW).
- Gemmrigheim (Kr. Ludwigsburg / BW).
- Gundelsheim-Tiefenbachtal (Kr. Heilbronn / BW).
- Hechingen-Stein (Zollernalbkreis / BW).
- Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kr. / BW).
- Karlsruhe-Durlach (Stadt Karlsruhe / BW).
- Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kr. / BW).
- eventuell (Klettgau-Geißlingen; Kr. Waldshut (BW).
- Ladenburg (Rhein-Neckar-Kr. / BW); Bauphase II.
- Laufenburg (Kr. Waldshut / BW).
- Lauffen am Neckar (Kr. Heilbronn / BW).
- Leinfelden-Echterdingen-Stetten a.d. Fildern (Kr. Esslingen / BW).
- Ludwigsburg-Hoheneck (Kr. Ludwigsburg / BW).
Haupthaus der Villa rustica von Bondorf
|
Villa rustica von Engen-Bargen
|
Haupthaus der Villa rustica "Ziegelscheuer" in
Ladenburg;
Bauphase II |
Haupthaus des Gutshofes von Ludwigsburg-Hoheneck
|
- Merdingen (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW).
- Mühlacker-Enzberg (Enzkreis / BW).
- Mühlacker-Lomersheim (Enzkreis / BW).
- Mundelsheim (Kr. Ludwigsburg / BW).
- Nagold (Kr. Calw / BW).
- Neustetten-Remmingsheim (Kr. Tübingen / BW).
- Nürtingen-Oberensingen (Kr. Esslingen (BW).
- Oberndorf-Bochingen am Neckar (Kr. Rottweil / BW).
- Oedheim (Kr. Heilbronn / BW).
- eventuell Ostfildern-Ruit (Kr. Esslingen / BW).
- Osterfingen (Kt. Schaffhausen / Schweiz).
- Pforzheim-Hagenschieß (Stadt Pforzheim / BW).
- Remseck am Neckar-Neckarrems (Rems-Murr-Kr. / BW).
- Reutlingen-Betzingen (Kr. Reutlingen / BW).
- Reutlingen-Mittelstadt (Kr. Reutlingen / BW).
- Sachsenheim-Großsachsenheim (Kr. Ludwigsburg / BW).
- Schorndorf-Schornbach (Rems-Murr-Kr. / BW).
- Schriesheim (Rhein-Neckar-Kr. / BW).
- Schwieberdingen (Kr. Ludwigsburg / BW).
- Schwörstadt (Kr. Lörrach / BW).
- Siblingen (Kt. Schaffhausen / Schweiz).
- Stammheim (Kr. Calw / BW).
Villa rustica "Schlößleäcker" in Mundelsheim
|
Gutshof Nagold
|
Villa rustica in Siblingen
|
Gutshof von Stammheim
|
- Starzach-Bierlingen (Kr. Tübingen / BW).
- Starzach-Börstingen (Kr. Tübingen / BW).
- Vaihingen-Enzweihingen a. d. Enz (Kr. Ludwigsburg / BW).
- Walldorf (Rhein-Neckar-Kr. / BW).
- Wolfschlugen (Kr. Esslingen / BW).
- eventuell Weinsberg (Kr. Heilbronn / BW).
Je nachdem wie stark die Risalite aus der Gebäudefront hervortreten, können
die Enden der Portikus gelegentlich auch entlang der Seitenwand der Risalite
abknicken, wodurch der ursprünglich gerade Säulengang einen U-förmigen Verlauf
erhält. Diese Variante ist im Arbeitsgebiet sowohl bei Haupthäusern mit Frontlängen
zwischen 30 und 40 m, wie beispielsweise in Hirschberg-Großsachsen (Rhein-Neckar-Kreis
/ BW) und Winningen (Kr. Mayen-Koblenz / RLP), als auch an so großen Anlagen
wie eventuell in Steinwenden (Kr. Kaiserslautern / RLP) mit einer Front von
92m belegt.
Haupthaus des Gutshofes von Winningen
|
|
Villa rustica von Hirschberg-Großsachsen
|
Haupthaus einer Villa rustica in Steinwenden
|
Haupthaus der Villa rustica von Weitersbach;
Grundrißentwicklung |
Haupthaus der Villa rustica "Ziegelscheuer" in
Ladenburg;
Bauphase III |
Haupthauskomplex der Villa rustica am "Weilberg" in
Bad Dürkheim-Ungstein
|
Villa rustica von Wachenheim
|
Weitere Herrenhäuser mit ausgeprägten Flügelbauten sind im linkrheinischen Raum etwa aus Bad Dürkheim-Ungstein (Kr. Bad Dürkheim-Weinstraße / RLP) und Wachenheim (Kr. Bad Dürkheim-Weinstraße / RLP) sowie im rechtsrheinischen Betrachtungsgebiet eventuell aus Rosenfeld (Zollernalbkr. / BW), Schleitheim (Kt. Schaffhausen / Schweiz) und Ubstadt-Weiher-Stettfeld (Kr. Karlsruhe / BW) sowie mit gewissem Vorbehalt auch aus Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW) belegt. Dabei handelt es sich durchweg um große bis sehr große Gebäude mit Frontlängen von mehr als 40 m bis über 110 m. Außer beim Gebäude von Rosenfeld, das nur einen geraden Säulengang zwischen den über 20m lang hervorragender Seitenflügel aufweist, ermöglichte in allen sonstigen Fällen die charakteristische, u-förmige Portikus dem Zugang vom Haupttrakt/-flügel zu den Seitenflügeln der Häuser. Bei der bislang nur im Luftbild erschlossenen, mehrflügeligen Großanlage von Ubstadt-Weiher-Stettfeld scheint sie sogar auf beiden Gebäudeseiten vorhanden zu sein.
Hauptgebäude eines Landgutes in Rosenfeld
|
Haupthaus der Villa rustica "Vorholz" bei
Schleitheim
|
Gutshof von Ubstadt-Weiher-Stettfeld
|
Haupthaus des Landgutes von Heitersheim;
Bauphasen II bis III |
Haupthaus des Landgutes von Heitersheim;
Bauphase IV |
Etwas aus dem Rahmen fällt auch die Anlage von Heitersheim, deren u-förmige Portikus sich, entsprechend dem Konzept italischer Landhäuser, zum Garten auf der Rückseite des Gebäudes öffnete und zeitweise (während der Bauphase III) gar zu einem geschlossenen Peristyl mit zentralem Wasserbecken umgebaut war. Wie etwa Befunde aus Villen im schweizerischen Teil Obergermaniens zeigen (siehe z.B. in Dietikon; Kt. Zürich), ist jedoch auch bei Portikusvillen mit frontseitig geöffneten Flügeln mit einer repräsentativen Garten- oder Platzarchitektur im Hof zwischen den Gebäudetrakten zu rechnen. Im vorliegenden Betrachtungsgebiet deuten zumindest große Zierbecken vor den Fassaden der Herrenhäusern in Grenzach-Wyhlen (Kr. Lörrach / BW) und Hirschberg-Großsachsen (Rhein-Neckar-Kreis / BW) auf vergleichbare Gepflogenheiten hin.
Wasserbecken vor dem Haupthaus der Villa rustica
von Grenzach-Wyhlen
|
Wasserbecken vor dem Haupthaus der Villa rustica
von Hirschberg-Großsachsen
|
Das wiederum rückwärtige Wasserbecken einer Villa rustica in Güglingen-Frauenzimmern (Kr. Heilbronn / BW) enthielt zudem zahlreiche Skulpturenfragmente, die zumindest teilweise zur Ausstattung des Gartenbereiches gehörten und in Form mythologischer Darstellungen aus der Odyssee, einer Gigantomachie sowie von Nymphen und Delphinen die Bildung und mediterranen Bezüge des Hausherren illustrieren.
Gutshof in Güglingen-Frauenzimmern; Gesamtplan
und Skulpturen aus der Verfüllung des Wasserbeckens
|
Gutshof in Güglingen-Frauenzimmern; Skulpturenfragmente
aus der Verfüllung des Wasserbeckens
|
Generell fällt der Ausstattungsluxus der Villen im Arbeitsgebiet höchst
unterschiedlich aus, bleibt jedoch insgesamt betrachtet hinter dem der Anlagen
im südlichen, schweizerischen Teil Obergermaniens zurück.
An Wandmalereien sind neben ein- oder mehrfarbig getünchten Wände und einfachen
Feldereinteilungen auch kleinteiligere geometrische Muster, Marmorimitationen
und vor allem florale Motive relativ häufig belegt. Wesentlich seltener sind
hingegen figürliche Szenen. Zum Teil sehr qualitätvolle Beispiele für Wand-
und Deckenmalereien sind links des Rheins etwa aus der "Palast"-Villa
in Bad Kreuznach (Kr. Bad Kreuznach / RLP) sowie Hauptgebäuden in Bingen-Kempten
(Kr. Mainz-Bingen / RLP), Mühlheim-Kärlich und Mühlheim-Kärlich-Depot (Kr.
Mayen-Koblenz / RLP) oder auch Wachenheim (Kr. Bad Dürkheim-Weinstraße) zu
nennen. Ihnen lassen sich an rechtrheinischen Fundplätzen u.a. Gutshöfe wie
Grenzach-Wyhlen (Kr. Lörrach / BW), Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald
/ BW), Ladenburg (Rhein-Neckar-Kr. / BW), Laufenburg (Kr. Waldshut / BW), Walldorf
(Rhein-Neckar-Kr.) sowie der in seiner Bedeutung diskutable Baukomplex
in Hohberg-Niederschopfheim (Ortenaukr. / BW) zur Seite stellen.
Haupthaus der Villa rustica von Wachenheim; Wandmalereien
und Wanddekoration
|
Haupthaus der Villa rustica "Ziegelscheuer" in
Ladenburg; Wandmalereien und Wanddekoration
|
Haupthaus der Villa rustica in Mühlheim-Kärlich-Depot;
figürliche Wandmalerei
|
Haupthaus des Gutshofes in Grenzach-Wyhlen; figürliche
Wandmalerei
|
Wenngleich im Betrachtungsraum bislang keine direkte Abhängigkeit zwischen
der Gutshofgröße und der Verwendung von Wandmalereien feststellbar ist, scheinen
zumindest aufwendigere Dekore doch überwiegend erst bei Haupthäusern ab mittlerer
Größe vertreten zu sein. Die Thematik der wenigen figuralen Malereien, so
beispielsweise die Geburt der Venus aus der Villa in Mülheim-Kärlich-Depot
oder vermutlich der Kampf zwischen Lapithen und Kentauren im Herrenhaus von
Grenzach-Wyhlen, läßt als Auftraggeber mitunter römisch/mediterran gebildete
Leute vermuten.
An sonstigen Wanddekoren sind aus manchen größeren Herrenhäusern, so etwa in
Boos (Kr. Bad Kreuznach / RLP), Steinwenden (Kr. Kaiserslautern / RLP), Grenzach-Wyhlen
(Kr. Lörrach / BW) oder Bad Kreuznach (Kr. Bad Kreuznach / RLP), des weiteren
Stuckelemente oder, z.B. aus Ettlingen (Kr. Karlsruhe / BW), gar skulptierte
Gesimse nachgewiesen.
Haupthaus des Gutshofes von Boos; Fragment eines
Stuckgesimses
|
Haupthaus des Gutshofes in Grenzach-Wyhlen; Stuck-
und Marmorfragmente
|
Gutshof am Hedwigshof bei Ettlingen; Architekturteile
|
Zudem fanden sich Hinweise auf marmorne Wand- und/oder Bodenbeläge, außer an einigen der zuvor genannten Fundplätze, u.a. auch in Auggen (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW) und den Gutshäusern im "Vorholz" bei Schleitheim (Kt. Schaffhausen / Schweiz) oder im "Gurtweiler Tal" bei Waldshut (Stadt Waldshut-Tiengen / BW). Die Spitze des Ausstattungsluxus aber bilden Opus sectile-Beläge, wie sie am letztgenannten Fundplatz sowie aus den Großvillen in Bad Kreuznach (Kr. Bad Kreuznach / RLP), Grenzach-Wyhlen (Kr. Lörrach / BW) und Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW) belegt sind. Von den aufgezählten Orten stammen schließlich auch einige der im Betrachtungsgebiet relativ seltenen Hinweise auf Mosaikböden. Ergänzend sind hierzu auch noch Landgüter in Auggen (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW), Boos (Kr. Bad Kreuznach / RLP), Steinwenden (Kr. Kaiserslautern / RLP), Laufenburg (Kr. Waldshut / BW) und im "Vorholz" bei Schleitheim (Kt. Schaffhausen / Schweiz) oder der Gebäudekomplex von Hohberg-Niederschopfheim (Ortenaukr. / BW.) anzufügen.
Haupthaus des Landgutes von Heitersheim; Teile
eines Bodenbelages
|
Haupthaus des Landguts an der Hüffelsheimer Straße
in Bad Kreuznach; Bodenmosaik
|
Haupthaus der Villa rustica "Vorholz" bei
Schleitheim; Mosaikteile
|
Zusammenfassend betrachtet drängt sich dabei der Eindruck auf, daß sich
die besonders reich ausgestatteten Villen vor allem im linksrheinischen Gebiet
und im flußnahen Bereich rechts des Rheines konzentrieren, während zum Limes
hin der Materialprunk spürbar abzunehmen scheint.
In dieses Bild fügen sich dann auch die Marmorverkleidungen aus den separaten
Badegebäuden von Gutshöfen in Bruchsaal-Obergrombach (Kr. Karlsruhe / BW) und
Merdingen (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW) gut ein.
Sieht man von Kleinstbauernhöfen (näheres dazu siehe weiter oben) und wenigen
weiteren Ausnahmen ab, gehören Baderäume bei den Villae rusticae des Arbeitsgebietes
zur Regelausstattung. Sie sind dabei entweder unmittelbar am Haupthaus an-
bzw. eingebaut oder alternativ in einem separaten Gebäude untergebracht.
Wie Beispiele aus Ettlingen (Kr. Karlsruhe / BW), Hechingen-Stein (Zollernalbkreis
/ BW) oder Weinsberg (Kr. Heilbronn / BW) zeigen, konnten allerdings auch ursprünglich
separate Badegebäude im Verlauf der baulichen Entwicklung der Gesamtanlage
durch eine Portikus bzw. Portikusverlängerung nachträglich mit dem Haupthaus
verbunden oder, wie in Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW), durch
zwischengesetzte Räumlichkeiten ganz von ihm vereinnahmt werden.
Villa rustica von Hechingen-Stein;
Grundrißplan der Bauperiode II im 2. Jh. n.Chr. |
Villa rustica von Hechingen-Stein;
Grundrißplan der Bauperiode III/Phase 3 während der 1. Hälfte des 3. Jh. n.Chr. |
Villa rustica von Weinsberg;
Grundrißplan des jüngsten Bauzustandes |
Während links des Rheines ein deutliches Übergewicht integrierter Bäder zu beobachten ist, bevorzugte man zwischen Rhein und Limes offenbar eigenständige Badegebäude. Die Mehrzahl letzterer, wie auch viele der integrierten Anlagen, gehört in ihrer Bauweise zum sogenannten Blocktyp, bei dem die Räume in wenigstens zwei Reihen, oft Heizraum und Warmbad neben Kalt- und Laubad, angeordnet sind und sich somit ein kompakter, tendenziell rechteckiger Baukörper oder Block ergibt.
Blocktyp in Merdingen
|
Blocktyp in Niedereschach-Fischbach
|
Reihentyp in Bietigheim-Bissingen
|
Reihentyp in Freiberg-Beihingen a. N.
|
Alternativ dazu und wesentlich weniger platzsparend können die einzelnen Räume aber auch in einer Reihe hintereinander liegen. Vertreter dieses sogenannten Reihentyps sind etwa aus der 1. Steinbauphase des Guthofes von Bietigheim-Bissingen (Kr. Ludwigsburg / BW) oder einem Villenareal bei Freiberg-Beihingen a. N. (Kr. Ludwigsburg / BW) bekannt.
Haupthaus mit potentiellem Baderaum in Bad Kreuznach
|
Haupthaus mit potentiellem Baderaum in Herschweiler-Pettersheim
|
Generell reicht der Umfang der Badeinrichtungen von Kleinstinstallationen, wie den möglicherweise nur mit einer Wanne ausgestatten Einzelräumen in Haupthäusern von Bad Kreuznach (Kr. Bad Kreuznach / RLP) oder Herschweiler-Pettersheim (Kr. Kusel / RLP), über mittelgroße Anlagen, wie z.B. in Weiler bei Bingen (Kr. Mainz-Bingen), Laufen a. N. (Kr. Heilbronn / BW) oder Laufenburg (Kr. Waldshut / BW), bis hin zu großzügig ausgelegten, repräsentativen Badegebäuden wie beispielweise in Hirschberg-Großsachsen (Rhein-Neckar-Kr. / BW) oder Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald /BW). Neben Räumen für die üblichen drei Badegänge können diese u.a. auch noch ein Schwitzbad (sudatorium) oder sogar, wie im Fall der Villa von Heitersheim, eine angegliederte Palaestra aufweisen.
Haupthaus mit integriertem Badetrakt in Weiler
bei Bingen
|
Haupthaus mit integriertem Badetrakt in Lauffen
a. N.
|
Haupthaus mit integriertem Badetrakt in Laufenburg
|
Badegebäude der Villa rustica von Hirschberg-Großsachsen
|
Badegebäude des Landgutes von Heitersheim
|
Immerhin sind bei den meisten Villen im Betrachtungsgebiet zumindest ein Kalt- und ein Warmbaderaum (frigidarium und caldarium) sowie mehrheitlich auch noch ein Laubad (tepidarium) vertreten. Wie etwa der verhältnismäßig bescheidene Badetrakt des großflächigen Herrenhauses von Bad Dürkheim-Ungstein (Bad Dürkheim-Weinstraße / RLP) verdeutlicht, muß sich die Größe der Bäder dabei nicht zwangsläufig proportional zu der des Haupthauses verhalten. In vereinzelten Fällen sind sogar zwei voneinander getrennte Bäder nachgewiesen. Während das zweite Badegebäude auf dem Areal des Gutshofes von Hechingen-Stein (Zollernalbkreis / BW) noch weitgehend unerforscht ist und somit derzeit nicht eindeutig bestimmt werden kann, inwieweit es tatsächlich gleichzeitig mit dem anderen betrieben wurde, scheint bei einer Villa rustica in Wachenheim (Bad Dürkheim-Weinstraße / RLP) nichts gegen eine parallele Nutzung der beiden in das Haupthaus integrierten, voneinander unabhängigen Bäder zu sprechen.
Haupthaus mit integriertem Badetrakt in Bad Dürkheim-Ungstein
|
Villa rustica von Hechingen-Stein;
Gesamtplan |
Haupthaus mit zwei integrierten Bädern in Wachenheim
|
Die Wasserversorgung der Bäder sowie der Gutshöfe allgemein war im Betrachtungsgebiet sowohl durch Wasserleitungen als auch Tiefbrunnen sichergestellt, ohne daß sich bislang die Bevorzugung einer der beiden Möglichkeiten abzeichnet. Kleinen Zisternen, wie einem zu diesem Zweck verschalten Karsttrichter (Doline) im Bereich der Villa rustica in Bondorf (Kr. Böblingen / BW) oder einem quadratischen Bau an der nordwestlichen Hofmauer der älteren Steinbauphase des Gutshofes von Sachsenheim-Großsachsenheim (Kr. Ludwigsburg / BW), ist hingegen nicht mehr als eine ergänzende Funktion beizumessen. Wasserversorgungsleitungen sind sowohl als Blei- und Tonrohre belegt, so z.B. bei der "Palastvilla" von Bad Kreuznach (Kr. Bad Kreuznach / RLP) oder in Weitersbach (Kr. Birkenfeld / RLP), als auch in Form steinerner Rinnen bekannt, wie etwa bei Gutshöfen am Annaberg in Bad Dürkheim (Bad Dürkheim-Weinstraße / RLP), Beringen (Kt. Schaffhausen / Schweiz) oder Eutingen-Rohrdorf (Kr. Freudenstadt / BW). Eine der häufigsten Bauweisen bilden jedoch Holzleitungen aus in Längsrichtung durchbohrten Baumstammabschnitten (Deichel/Deuchel bzw. Teuchel). Entsprechende Leitungen fanden dabei wohl keinesfalls nur bei kurzen Distanzen Verwendung, sondern können, wie ein möglicherweise bis zu 3 km langes Beispiel in Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW) verdeutlicht, auch größere Entfernungen überbrückt haben. Außer Verfärbungen des vergangenen Holzes und den zugehörigen Kanalgräben, werden des öfteren, so z.B. bei einem Guthof in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kr. / BW), noch die eisernen Verbindungsringe der einzelnen Deuchel gefunden.
Gutshof von Hirschberg-Großsachsen; Spuren einer
Deuchelleitung
|
Villa rustica "Ziegelscheuer" in Ladenburg;
Fassungs-/Verbindungsringe verschiedener Deuchelleitungen
|
Villa rustica in Nürtingen-Oberensingen; eiserner
Deuchelring
|
Im Falle einer Villa in Nürtingen-Oberensingen (Kr. Esslingen / BW) hatte
sich innerhalb derselben zudem noch der versinterte Leitungskern erhalten.
Eine mögliche Alternative zur Deuchelröhre kam anscheinend bei einem Gehöft
in Ostfildern-Ruit (Kr. Esslingen) zur Anwendung, das offenbar eine Leitung
mit einer Einfassung aus Eichendielen besaßt
Wie die Wasserleitungen, so sind auch die Tiefbrunnen sowohl mit steinerner
als auch hölzerner Innenwandung belegt. Ihre Zahl schwankt von einem bis zu
mindestens vier Schächten pro Hof, wie z.B. auf einem Gut in Walldorf (Rhein-Neckar-Kr.
/ BW), die jedoch nicht alle gleichzeitig in Benutzung gewesen sein müssen.
Ein gutes Konstruktionsbeispiel eines Holzbrunnens stammt etwa vom Areal der
Villa rustica von Hirschberg-Großsachsen (Rhein-Neckar-Kr. / BW). Über einem
kreisrunden, sich nach unten verjüngenden Sickerkasten aus senkrecht gestellten
Brettern (ehemaliges Faß?) an der Brunnensohle erhob sich hier eine quadratische
Holzkastenkonstruktion, deren Außenseite mit einer Packung aus Bruchsteinen
und tonig-sandigem Material hinterfüttert bzw. abgedichtet war.
Gutshof von Winningen; Steinbrunnen
|
Villa rustica von Hirschberg-Großsachsen; Holzkastenbrunnen
|
Vermutlich primär als Brauch- und Löschwasserergänzung genutzte Tümpel oder Teiche, wie sie etwa des öfteren innerhalb der Hofareale niedergermanischer Villae rusticae beobachtet wurden, konnte im vorliegenden obergermanischen Arbeitsgebiet bislang nicht nachgewiesen werden.
Gutshof von Oberndorf-Bochingen a. N.
|
Villa rustica von Vaihingen-Enzweihingen a. d. E.
|
Villa rustica in Niedereschach-Fischbach
|
Nebenwohnhaus des Gutshofes von Lauffen a. N.
|
Unter den Nebenbauten treten auf mehreren Gutshöfen im Arbeitsgebiet Häuser auf, die primär als Wohnbauten eingestuft werden können und vermutlich zur Unterbringung von Gesinde bzw. vom Gutshofbetreiber abhängiger Familien dienten. Darüber hinausgehende Überlegungen, daß sie bei Gehöften in Straßennähe mitunter vielleicht auch als Herberge (Mansio) für Reisende genutzt wurden, sind zwar bedenkenswert, aber bislang rein hypothetisch. Entsprechende Bauten vom Zentralhoftyp aus Vaihingen-Enzweihingen a. d. E. (Kr. Ludwigsburg / BW) oder mit vorgelagerter Portikus, wie etwa in Niedereschach-Fischbach (Schwarzwald-Baar-Kreis / BW), lassen dabei durchaus Anklänge an die Gestaltung von Hauptgebäuden erkennen. Zu einem Wohngebäude mit talseitiger Portikus, farbigem Wandputz und hypokaustiertem Wohnraum in der Villa rustica von Lauffen (Kr. Heilbronn / BW) gibt es dann auch Vermutungen, ob es sich nicht gar um ein älteres Haupthaus handeln könnte, das nach Errichtung eines größeren Neubaus vielleicht den Kindern des Hofbesitzers/-pächters als Wohnung zufiel. Zweitwohnhäuser mit Wandmalerein und beheizten Räumen sind etwa auch auf Gutshöfen in Bietigheim-Bissingen (Kr. Ludwigsburg / BW) und Kirchheim a. N. (Kr. Ludwigsburg / BW) nachgewiesen. In der Regel beschränkte sich der Ausstattungsluxus der Nebengebäude allerdings wohl höchstens auf farbigen Wandputz, wie etwa in Grenzach-Wyhlen (Kr. Lörrach / BW) oder Niedereschah-Fischbach (Schwarzwald-Baar-Kreis / BW).
Wohn- und Wirtschaftsbau der Villa rustica in Bad
Dürkheim-Ungstein
|
Villa rustica von Pforzheim-Hagenschieß
|
Badegebäude mit angegliederten Wohn-/Wirtschaftsräumen
in Ludwigsburg-Hoheneck
|
Villa rustica in Thallichtenberg
|
Zumindest ebenso häufig wie in reinen Wohnbauten, wird man letztlich von einer
Unterbringung des Gesindes in den Wirtschaftsgebäuden ausgehen können, auch
wenn die sichere Identifizierung einer solchen dualen Nutzung nicht immer ganz
einfach ist. Immerhin sind beispielsweise in Bad Dürkheim-Ungstein (Bad Dürkheim-Weinstraße
/ RLP) mögliche Wohnräume in einem Bau untergebracht, der eventuell zur Lagerung
und/oder Eindickung von Traubenmost genutzt wurde. Auf Aufenthalts- bzw. Unterkunftsmöglichkeiten
deuten etwa auch Reste farbigen Wandputzes in einem primären Speicherbau in
Bad Rappenau-Babstadt (Kr. Heilbronn / BW) hin, während ein Haus vom Zentralhoftyp
in Pforzheim-Hagenschieß (Stadt Pforzheim / BW) außer zur Beherbergung von
Personen auch als Remise gedient haben soll. In Ludwigsburg-Hoheneck (Kr. Ludwigsburg
/ BW) sind vergleichbare Überlegungen eventuell für Gebäudetrakte angebracht,
die während der 2. und 3. Steinbauphase das separate Badegebäude schrittweise
zu einem Haus von Zentralhoftyp erweiterten. Ebenfalls durch ein integriertes
Bad, daneben jedoch Öfen und Wannen, die vielleicht auf eine Schmiede hindeuten,
ist ein Bau in Thallichtenberg (Kr. Kusel / RLP) geprägt. Allerdings ist hier
unklar, ob die gewerbliche Nutzung nicht erst im Anschluß an die wohntechnische
erfolgte. Kombinierte Wirtschafts- und Wohnnutzungen muß man, u.a. in Analogie
zu dieser auf vergleichbar strukturierten Gutshöfen im schweizerischen Teil
Obergermaniens mehrfach belegten Verfahrensweise, schließlich auch für mehrere
der Bauten innerhalb der Pars rustica der Axialvilla von Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald
/ BW) vorauszusetzen. Die Liste von Gebäuden für die man entsprechende Überlegungen
anzustellen könnte, ließe sich im vorliegenden Betrachtungsgebiet so noch beliebig
fortsetzen.
Zu einem gewissen Teil auf Vermutungen basieren auch die Aussagen zu den wirtschaftlichen
Grundlagen einzelner Gehöfte, sofern sie nicht durch charakteristische Bauten
bzw. Installationen innerhalb des Hofareals näher erhellt werden. Einen guten
Beleg für Feldwirtschaft oder zumindest die Weiterverarbeitung von entsprechenden
Erträgen bilden etwa Trockenöfen (Darren), die während der mittleren Kaiserzeit
auf zahlreichen Gutshöfen des Arbeitsgebietes installiert wurden.
Villa rustica von Bruchsal-Obergrombach
|
|
Mühlengebäude C der Villa rustica von Hechingen-Stein
|
Villa rustica von Walldorf; Darrengebäude und künstlicher
Bachlauf
|
Mancherorts, wie etwa in Bruchsal-Obergrombach (Kr. Karlsruhe / BW), wo zwei Flachs- und zwei Getreidedarren in einem Gebäude (Bau H) untergebracht waren, oder in Hechingen-Stein (Zollernalbkreis / BW), wo in Gebäude C neben drei gleichzeitig betriebenen Darren auch eine große Mühle und Fragmente von Aufbewahrungsgefäßen (Dolien) zu Tage kamen, läßt sich dabei eine recht hohe Arbeitskapazität nachweisen. Dies gilt auch für eine Villa rustica in Walldorf (Rhein-Neckar-Kr. / BW), in deren Darrengebäude (Bau 12) mit drei Öfen zahlreiche Mühlsteinteile verbaut waren. In Verbindung mit einem unmittelbar am Haus vorbeifließenden, künstlichen Bachlauf läßt sich somit in der Nähe der Darren eine Wassermühle vermuten. Alternativ dazu liegen beispielsweise aus einem Gutshof in Ludwigsburg-Hoheneck (Kr. Ludwigsburg / BW) Teile einer großen Göpelmühle vor. Den Umfang agrarischer Leistungsfähigkeit der Walldorfer Villa verdeutlichen, abgesehen von dem Darrengebäude mit seinen noch vorauszusetzenden Lagerraumkapazitäten, jedoch am besten drei im Hofareal nachgewiesene große Nebenbauten von langrechteckiger Form.
Gesamtplan
|
Hölzerner Speicherbau(?) (Bau 4)
|
Steinerner Speicherbau (Bau 6)
|
Steinerner Speicherbau (Bau 13)
|
Beim ältesten von ihnen (Bau 4) handelt es sich um einen 25 x 11 Meter großen Holzpfostenbau, der von seiner Ausrichtung her noch der Holzbauphase des Gutshofes zugerechnet werden kann. Nebengebäude vergleichbarer Bauweise und mitunter auch Dimensionierung sind etwa bei Villen im Süden der Provinz Niedergermanien häufiger belegt. Da keine charakteristischen Merkmale, wie z.B. Unterzüge für einen zwecks Luftzirkulation erhabenen Boden, nachzuweisen waren, beruht seine Funktionseinstufung wohl im wesentlichen auf der der beiden jüngeren Steingebäude 6 und 13. Während beim 32 x 18 Meter großen Rechteckbau Nr. 6 zahlreiche pfeilerartige Wandverstärkungen mit einer Basis aus Sandsteinblöcken (Länge/Höhe: 1,5 x 0,6 m) in die Außenmauern einbezogen waren, läßt sich für das Innere des über 1000 m2 messende Gebäudes Nr. 13 eine parallel zu den Außenwänden umlaufende Unterkonstruktion aus noch weit größeren, jeweils mehrere Meter langen sowie über 1 m breiten und tiefen Sandsteinen rekonstruieren. Form und Konstruktionsdetails der Gebäude erlauben eine Interpretation als Speicherbauten (horrea).
Steinerner Speicherbau aus Bad Rappenau
|
Villa rustica von Bad Rappenau-Babstadt
|
Speicherbau in der Nordostecke des Gutshofes von
Ludwigsburg-Hoheneck
|
Villa rustica von Merdingen
|
Villa rustica von Sachsenheim-Großsachsenheim
|
Weitere Horrea sind beispielsweise auch aus Bad Rappenau und Bad Rappenau-Babstadt (Kr. Heilbronn / BW), Ludwigsburg-Hoheneck (Kr. Ludwigsburg / BW), Merdingen (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW) oder Sachsenheim-Großsachsenheim (Kr. Ludwigsburg / BW) bekannt. Wie besonders die letztgenannten beiden Beispiele zeigen, deren Bodenunterzüge keine Zweifel an ihrer Bestimmung aufkommen lassen, ist dabei durchaus noch mit anders proportionierten und teilweise auch in kleinere Raumeinheiten untergliederten Bauten zu rechnen. Gewisse Ähnlichkeiten zum Speicher aus Sachsenheim-Großsachsenheim zeigen etwa auch das vermutete Horreum eines Gutshofes in Bietigheim-Bissingen (Kr. Ludwigsburg / BW) oder der befahrbare Lagerbau einer Villa rustica oder Handelsstation(?) in Oberderdingen-Flehingen/Bauerbach (Kr. Karlsruhe / BW).
Villa rustica oder Handelsstation von Oberderdingen-Flehingen/Bauerbach
|
Speicher-/Lagerbau eines Gutshofes in Remchingen-Wilferdingen
|
Befahrbare Lagergebäude sind auf Guthöfen des öfteren belegt. Wie im zuvor genannten Fall oder bei einem Bau in Remchingen-Wilferdingen (Enzkreis / BW), können ihre Innenräume partielle Steinpflasterungen aufweisen. In Remchingen-Wilferdingen wird diese durch eine befestigte Zufahrtsrampe in der Gebäudemitte begrenzt. Für die Gebäudehälfte jenseits der Rampe läßt sich, u.a. nach Ausweis zahlreich gefundener Eisennägel, zunächst eventuell ein erhöhter Dielenboden rekonstruieren, bevor hier in einer späteren Phase zwei handwerklich genutzte Herdstellen angelegt wurden. Gegenüber solchen Details liegen meist nur wenige Hinweise zur Gesamtarchitektur entsprechender Nebengebäude vor.
Nebengebäude 4 des Gutshofes von Oberndorf-Bochingen
a. N.
|
Nebengebäude 3 des Gutshofes von Oberndorf-Bochingen
a. N.
|
Umso wertvoller ist deshalb ein Befund aus einem Gutshof in Oberndorf-Bochingen a. N. (Kr. Rottweil / BW), wo die Wände zweier steinerner Wirtschaftsbauten, der kleinere davon wiederum mit zentraler Zufahrt, vermutlich bei einem Erdbeben im Verlauf des 3. Jh. vollständig ungekippt sind. Neben technischen Erkenntnissen zu den zweischaligen, am Übergang zum Giebelfeld bzw. an der Traufe teils mit Steinplattenreihen und Gesimsen ausgestatteten Mauern, sind vor allen Dingen die Wandmaße bemerkenswert. Sie lassen für das mit 18 x 15 m Grundfläche größere der beiden Gebäude eine Traufhöhe von 7,1 m und eine Firsthöhe von 12 m errechnen, während der mit nur 15 x 10 m Fläche deutlich kleinere Bau (mit 5,5 m hohem Zufahrtstor und 2 m hohen Fenstern) sogar eine Traufhöhe von 7,5 m erreichte. Aus diesen Dimensionen wird deutlich, daß bei vielen steinernen Wirtschaftbauten wahrscheinlich mit einer Mehrgeschossigkeit oder zumindest partiellen Zwischenböden und damit einer wesentlich größeren Gebäudekapazität gerechnet werden muß, als der Grundriß in der Regel suggeriert.
Gesamt- und Detailplan eines Gutshofes in Kirchheim a.N.
|
Ein gutes Beispiel hierfür bilden etwa auch im Verlauf der mittleren Kaiserzeit auftretende turmartige Speicherbauten über verhältnismäßig kleinen, jedoch meist stark fundamentierten, quadratischen Mauergevierten. Teils an andere Gebäude angefügte, mögliche Turmspeichergrundrisse kommen beispielsweise in Villae rusticae in Mayen (Kr. Mayen-Koblenz / RLP), Mühlacker-Enzberg (Enzkreis / BW) oder Starzach-Bierlingen (Kr. Tübingen / BW) vor.
Kelterhaus der Villa rustica am "Weilberg" in
Bad Dürkheim-Ungstein
|
Hinweise auf Mostproduktion aus dem Wohn- und Wirtschaftgebäude
4
|
Einen besonderen Zweig der Landwirtschaft bildete und bildet in manchen Teilen des Betrachtungsgebietes bis heute der Weinanbau. Sieht man von Kleinfundbelegen wie Winzermesser ab, ist der archäologische Niederschlag dieses Erwerbszweiges allerdings gering. Den bislang besten Beleg stellt zweifelsohne das Kelterhaus einer Villa in Bad Dürkheim-Ungstein (Kr. Bad Dürkheim-Weinstraße / RLP) dar. Der in den Hang eingebettete, rechteckige Steinbau war möglicherweise nur teilüberdacht und besitzt vor der Wand zu einem abgeteilten, wahrscheinlich als Lager dienenden Raum eine Anlage aus drei Becken mit wasserdichtem Estrich. Der Boden der beiden langrechteckigen größeren Wannen, in denen die Weintrauben mit den Füßen zertreten wurden, ist dabei so geneigt, daß der Most über eine Röhre an ihren Schmalseiten in ein zwischen ihnen befindliches, quadratisches Sammelbecken ablaufen konnte. Zur restlichen Entsaftung der Maische ist in dem groß bemessenen Gebäude sicherlich auch noch eine mechanische Kelter zu rekonstruieren, von der allerdings keine Rest mehr nachzuweisen waren. Der Umfang der ursprünglich nur mit einem Tretbecken ausgestatteten und später erweiterten Anlane läßt auf eine beachtliche Produktionskapazität schließen. Neben Wein wurden hier offenbar auch Traubenmostkonzentrate zum Süßen von Speisen hergestellt. Darauf läßt zumindest ein für den Erhitzungs-/Eindickungsprozeß typisches Bleigefäß aus einem anderen Nebengebäude (Bau 4) desselben Guthofes schließen, in dessen Oxydschicht noch zahlreiche Rebkerne enthalten waren.
Vermutetes Kelterhaus des Gutshofes von Lauffen
a. N.
|
Gutshofes von Winningen; mögliches Mostbecken
|
Villa rustica in Mühlacker-Enzberg; potentielles
Mostbecken
|
Abgesehen von den zweifelfreien Befunden in Ungstein wurde auf Basis seines
Grundrisses, der allerdings keine Spuren technischer Anlagen mehr enthält,
auch für ein steinernes Nebengebäude der Villa von Laufen a. N. (Kr. Heilbronn
/ BW) gelegentlich eine Funktion als Kelterhaus diskutiert. Sie bleibt letztlich
jedoch ebenso ungewiß, wie die Bestimmung zweier hochliegender, quadratischer
Wannen im offenbar vielseitig genutzten Nebengebäude C eines Gutshofes in Winningen
(Kr. Mayen-Koblenz / RLP), für die vom Ausgräber eine mögliche Nutzung als
Mostbecken erwogen wurde. Ein vergleichbares, bislang ebenso interpretiertes
Becken fand man auch im Nordrisalit eines Haupthauses in Mühlacker-Enzberg
(Enzkreis / BW).
Gegenüber der Agrarwirtschaft ist der Nachweis alternativer Wirtschaftgrundlagen
oder zumindest einträglicher Nebenerwerbszweige bei den Villen des Arbeitsgebietes
schwierig. Auf Tierzucht könnte vielleicht eine große, ummauerte Freifläche
innerhalb einer Hofanlage in Bietigheim-Bissingen (Kr. Ludwigsburg / BW) hinweisen.
Ein während der 2. Steinbauphase fünfeckig ummauertes Areal (Bau IX), bei dem
es sich eventuell um einen Reitplatz zur Ausbildung von Jungtieren handelt,
sowie große, anhand erhaltener Fäkalienrinnen zumindest teilweise als Stallungen
genutzte Wirtschaftsbauten (Bau XII-XIII), legen die Möglichkeit eine Pferdezucht
nahe.
Gutshof von Bietigheim-Bissingen
|
Villa rustica bzw. mögliche Fischzuchtanlage Herbolzheim
|
Eine Spezialisierung auf Fischzucht scheint hingegen in Herbolzheim (Kr. Emmendingen
/ BW) vorzuliegen. Zu der Anlage gehört u.a. ein u-förmiges Wirtschaftgebäude
mit steinerner Rückwand und, bis auf einem beheizten Wohnraum, wohl nur in
leichter Holzbauweise abgeteilten Räumlichkeiten, vor dessen offener Seite
ein von Wasserbecken und -gräben durchzogenes Areal mit partiellen Ziegelschuttpflasterungen
liegt. Die Haltung von Fischen kann natürlich auch für manche der großen Zierbecken
angenommen werden, die, wie weiter oben dargelegt, vor der Front bzw. im Umfeld
einiger Hauptgebäude beobachtet werden konnten. Allerdings wäre dabei wohl
weniger an eine Zucht oder einen Verkauf, als an eine Haltung für den Eigenbedarf
zu denken.
In diesem Sinne sind in erster Linie wohl auch noch einige weitere auf den
Guthöfen im Arbeitsgebiet belegt Tätigkeiten, wie etwa Schmiedehandwerk, Kalk-
und Ziegelproduktion oder Töpferei zu betrachten. Hinweise auf Metallverarbeitung
liegen meist in Form von Schlackenfunden, gelegentlich Schmelzöfen und vereinzelt,
wie z.B. aus dem rückwärtigen Haupthausbereich einer Villa in Schwörstadt (Kr.
Lörrach / BW), auch als Schmiedebarren vor. Umfangreiche Metallverarbeitungsplätze
sind etwa aus den großen Villenanlagen in Bad Dürkheim-Ungstein (Kr. Bad Dürkheim-Weinstraße
/ RLP) und Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald, BW) bekannt. Untersuchte
Schlackenfunde von letzteren Fundort enthielt außer Eisen auch Anteile von
Buntmetall und Silber. Neben der Instandhaltung und Fertigung der im landwirtschaftlichen
Betriebsablauf benötigten Werkzeuge und Ausrüstungsteile (so z.B. Nutztiergeschirre)
ist auch mit der Herstellung sämtlicher metallener Konstruktionselemente vor
Ort zu rechnen. Dies verdeutlichen recht gut die Überreste von fünf kleinen
Schmiedeöfen in Mühlacker-Enzberg (Enzkreis / BW), die auf Grund ihrer Befundlage
mit der Errichtungsphase der Hofgebäude in Verbindung gebracht werden können
und offensichtlich der temporären Fertigung von Nägeln und sonstigen Baubeschlägen
dienten.
Villa rustica in Mühlacker-Enzberg; temporär betriebene
Schmiedeöfen
|
|
Kalkbrennöfen auf dem Areal des Gutshofes in Korntal-Münchingen
|
Kalkbrennofen vor der Südmauer der Villa rustica
von Bondorf
|
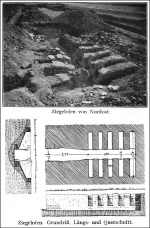 Einer
nur ähnlich kurzfristigen Nutzung während umfangreicherer Ausbauphasen waren
wahrscheinlich auch einige der Kalkbrennöfen unterworfen, die nahe beim oder
im Hofareal mancher Gutshöfe festgestellt wurden. Inwieweit jeweils gleich
zwei auf Besitzungen in Walldorf (Rhein-Neckar-Kr. / BW) und Korntal-Münchingen
(Kr. Ludwigsburg / BW) belegte Öfen vielleicht auch über das zur hofinternen
Bautätigkeit benötigte Maß hinaus produzierten, ist letztlich jedoch nicht
zu entscheiden. In Korntal-Münchingen überlagern sie einen zuvor genutzten
Ziegelbrennofen, der zu ihrer Errichtung aufgegeben und entsprechend umgebaut
worden ist. Dieser Befund unterstreicht den offensichtlich meist nur kurzfristigen
Charakter solcher zur Baumaterialfertigung benötigten technischen Anlagen.
Auch in den Villen von Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW) und
Ludwigsburg-Hoheneck (Kr. Ludwigsburg / BW) aufgedeckte Ziegelbrennöfen wurden
anscheinend nur während einzelner Bauphasen und nicht zu gewerblichen Zwecken
betrieben.
Einer
nur ähnlich kurzfristigen Nutzung während umfangreicherer Ausbauphasen waren
wahrscheinlich auch einige der Kalkbrennöfen unterworfen, die nahe beim oder
im Hofareal mancher Gutshöfe festgestellt wurden. Inwieweit jeweils gleich
zwei auf Besitzungen in Walldorf (Rhein-Neckar-Kr. / BW) und Korntal-Münchingen
(Kr. Ludwigsburg / BW) belegte Öfen vielleicht auch über das zur hofinternen
Bautätigkeit benötigte Maß hinaus produzierten, ist letztlich jedoch nicht
zu entscheiden. In Korntal-Münchingen überlagern sie einen zuvor genutzten
Ziegelbrennofen, der zu ihrer Errichtung aufgegeben und entsprechend umgebaut
worden ist. Dieser Befund unterstreicht den offensichtlich meist nur kurzfristigen
Charakter solcher zur Baumaterialfertigung benötigten technischen Anlagen.
Auch in den Villen von Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW) und
Ludwigsburg-Hoheneck (Kr. Ludwigsburg / BW) aufgedeckte Ziegelbrennöfen wurden
anscheinend nur während einzelner Bauphasen und nicht zu gewerblichen Zwecken
betrieben.
Ziegelbrennofen auf dem Areal des Gutshofes von Ludwigsburg-Hoheneck
Im Zusammenhang mit der Ergänzung des eigenen Bestandes und vielleicht der Verpackung landwirtschaftlicher Erzeugnisse dürften meist ebenso Belege für eine Keramikproduktion auf Gutshöfen zu sehen sein. Selbst der Betrieb gleich zweier Keramiköfen im Bereich der großen Villa rustica von Bad Dürkheim-Ungstein (Kr. Bad Dürkheim-Weinstraße / RLP) scheint dem dort zu erwartenden landwirtschaftlichen Produktionsumfang adäquat.
Keramikbrennöfen auf dem Areal des Gutshofes von
Heitersheim
|
Keramikfunde aus lokaler Produktion
|
Unwahrscheinlicher ist hingegen, daß eine zum Teil mit Stempel "L. I[---]" oder Handsignaturen "FON[---]" bzw. "FONTI" gekennzeichnete, glattwandige, beigefarbene Gebrauchskeramik, die in mindestens drei Öfen auf dem Gelände des Gutshofes von Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW) gebrannt wurde, ebenfalls nur der Deckung des Eigenbedarfs oder Verpackungszwecken diente. Die Kennzeichnung und das Formenspektrum dieser Ware, daß Kragen-, Kochschüsseln und Töpfe umfaßt, sprechen eher dafür, das sie wenigstens zum Teil auch für einen lokalen Absatzmarkt unbekannte Umfangs gefertigt wurde. Zumindest Versuche einer gewerblichen Keramikproduktion liegen eventuell auch aus Schwieberdingen (Kr. Ludwigsburg / BW) vor. Außer zwei Töpferöfen, von denen einer noch handaufgebaute römische Ware aus sehr mehligem Ton enthielt, stammt aus dem dortigen Villenareal ein Formschüsselfragment, das in Verbindung mit einer im Fundmaterial belegten grauscherbigen Keramik mit schlecht anhaftender, oranger Engobe möglicherweise den Versuch einer lokalen Terra sigillata-Herstellung dokumentiert.
Abgesehen von Wohn- und Wirtschaftgebäude sind im Betrachtungsgebiet auf mehreren
Gutshöfen Baulichkeiten vorhanden, für die man angesichts ihrer Grundrißform
eine Nutzung als Heiligtum in Erwägung zieht und in einigen Fällen durch entsprechende
Ausstattungsdetails und Kleinfunde auch belegen kann. In der Regel handelt
es sich bei ihnen um kleine rechteckige oder quadratische Mauergevierte ohne
erkennbare Innengliederung. Beim Ausbleiben interpretierbarer Kleinfunde schwankt
deshalb, je nach Stärke der Fundamente, die Interpretation der Gebäude zwischen
Heiligtum und Turmspeicher.
Etwas komplexere Tempelbauten, die sich, wie in Tengen-Büßlingen (Kr. Konstanz
/ BW), problemloser interpretieren lassen, bilden bislang Einzelerscheinungen.
Hier wurde ein gegenüber der Haupthausfront gelegener, ursprünglich ebenfalls
einräumiger Rechteckbau durch den Anbau einer wahrscheinlich offenen Vorhalle
mit auf Holzsäulen ruhendem Dach zu einem einfachen Prostylos ausgebaut.
Villa rustica in Tengen-Büßlingen; Tempel
|
Villa rustica im "Brasil" bei Mayen; Tempelbauten
|
Villa rustica im "Brasil" bei Mayen; Terrakottafigürchen
|
Ein kleiner, kapellenartiger Begleitbau, dessen Eingang, wie beim größeren, älteren
Kultgebäude vom Gutshofgelände weg nach Osten orientiert war, erleichtert immerhin
auch bei einem leicht trapezoiden Einraumbau auf einem Guthof in Mayen (Kr.
Mayen-Koblenz / RLP) die Interpretation als Heiligtum. Zahlreiche Fragmente
von Altären, Steinfiguren, Terrakottafigürchen (u.a. Matrone und eventuell
Venus), Räucherkelchen und keramischen Miniaturgeschirr, die um die Bauten
und an anderen Stellen des Hofareals entdeckt wurden, unterstreichen allerdings
auch die Existenz eines solchen Gebäudes am Ort.
Daß aus der simplen Grundrißform der meisten Heiligtümer nicht unbedingt
Rückschüsse
auf deren Bauausstattung zu ziehen sind, zeigt ein Beispiel aus einer Villa
in Bondorf (Kr. Böblingen / BW). Dem wie in Tengen-Büßlingen ebenfalls vis-à-vis
des Hauptgebäudes gelegenen, einräumige Rechteckbau mit sorgfältig gesetztem
Mauerwerk, Estrichboden und Hinweisen auf eine rotbraune Ausmalung sind ansonsten
noch zahlreiche aus Sandstein gefertigte Architekturelemente, wie Gesimse,
Pilaster und Sockelteil,e zuordnen. Sie wurden zusammen mit den Fragmenten
von wenigstens sieben lebensgroßen Götterfiguren, darunter Merkur, Victoria
und anscheinend Mars, aus einer 15 Meter vom Gebäude entfernten Grube geborgen.
Villa rustica von Bondorf; Gesamtanlage mit markiertem
Tempel
|
Villa rustica von Bondorf; Beispielfunde aus dem
Tempel
|
Gutshof in Eutingen-Rohrdorf; Gesamtplan mit markiertem "heiligen" Bezirk
|
Gutshof in Eutingen-Rohrdorf; Skulpturen
|
Eine ähnliche Götterversammlung ist aus Eutingen-Rohrdorf (Kr. Freudenstadt / BW) bekannt. Entlang der Nordmauer eines trapezförmig ummauerten Annexes an der Nordwestecke der Hofeinfriedung einer Villa rustica existierte hier ein 30 m langes und nur 2,5 m bereites Gebäude. Es bestand aus einer nach Süden offenen Portikus, die von kleinen Räumlichkeiten flankiert wurde. In der Längsachse dieser Halle fanden sich noch elf Punktfundamente und ein Streifenfundament, auf denen ehemals mindestens zehn bis elf lebens- bis leicht überlebensgroße Götterfiguren standen. Nach ersten Sichtungen der zahlreichen Skulpturenfragmente aus Stubbensandstein sind unter ihnen Mars, zweimal Merkur, Minerva, Venus, Herkules, Diana oder Silvanus und entweder Apollo oder Juno vertreten. Außer der Götterhalle beherbergte der 1200 m2 große Annex lediglich noch zwei weitere einfache Rechteckbauten, von denen einer in die südwestliche und der andere in die südöstliche Ecke der Trennmauer zwischen dem Annex und dem übrigen Gutshofbereich integriert war. Über Hinweise auf ihre Funktion liegen bislang keine weiteren Aussagen vor.
Gesamtplan, Detailplan des Tempelbezirks sowie Frontansicht
einer rekonstruierten Kapelle
|
Beispielfragmente der Skulpturenausstattung und Bruchstücke
einer Jupitersäule
|
Ein weiterer ummauerter Kultbezirk konnte unmittelbar neben der Hofmauer einer
Villa rustica in Hechingen-Stein (Zollernalbkr. / BW) ergraben werden und ist
mit dieser durch eine kurze Stichmauer verbunden. Das einmal erweiterte, mit
einer ziegelgedeckten Mauer umfriedete Areal umfaßte in seiner letzten Phase
eine Fläche von rund 1000 m2. Außer zwei in die Südwest- bzw. Südostecke der
Mauer eingepaßten einfachen Gebäuden, die vielleicht der Aufbewahrung von liturgischen
Geräten und Weihegeschenken dienten, wurden insgesamt zehn kleine, kapellenartige
Bauten erkannt, deren quadratische Grundrisse sich über die gesamte Nord-/Nordosthälfte
der Anlage verteilen. Zahlreiche Skulpturenbruchstücke belegen, daß in ihnen
Götterbilder aufgestellt waren. Unter den Fragmenten ließen sich zumindest
Venus und Eroten, ein Relief der Diana und schließlich auch eine Stierskulptur
identifizieren, deren Aufstellung vielleicht mit östlichen Kulten, etwa dem
des Jupiter Dolichenus, in Verbindung zu bringen ist. Zudem fanden sich Reste
einer Jupitersäule mit einer Jupiter-Gigantengruppe als Krönungsfiguren.
Gegenüber der Variante des thronenden Jupiters, die etwa im Süden der Provinz
Niedergermanien überwiegt, bildet in Obergermanien der einen Giganten niederreitende
oder -fahrende Gott das häufigere Motiv. Die bereits ab neronischer Zeit im
Arbeitsgebiet belegten Säulen erlebten ihre besondere Blüte vor allem während
des 2. und 3. Jh. n.Chr.. Erhaltenen Stiftungsinschriften zufolge, wie z.B.
auf dem Begleitaltar einer Säule aus dem Bereich der Villa rustica von Niefern-Öschelbronn
(Enzkr. / BW), wurden sie oft in Erfüllung eines Gelübdes als Dankesgabe errichtet.
In Bauform und Skulpturenschmuck mischen sich in ihnen römische und einheimisch
keltische Glaubensvorstellungen. Von den Teilen mehreren hundert bislang bekannter
Säulen wurden nicht wenige auch auf dem Areal vermuteter oder durch Grabungen
gesicherter Gutshöfe geborgen.
Jupitergigantensäule der Villa rustica von Niefern-Öschelbronn;
Fragment des reitenden Jupiter
|
Jupitergigantensäule eines Gutshofes Mosbach-Diedesheim
|
Jupitergigantensäule eines Gutshofes Mosbach-Diedesheim
|
Wie beispielsweise in Gundelsheim-Böttingen (Kr. Heilbronn / BW), Mosbach-Diedesheim
(Neckar-Odenwald-Kr. / BW) oder auch Mühlacker-Enzberg (Enzkr. / BW), fanden
sich Trümmer der Säulen dabei nicht selten in der Verfüllung von Brunnen. Abgesehen
von dem naheliegenden Gedanken an eine bloße Entsorgung, könnte sich in diesem
Phänomen eventuell auch eine Art von ritueller Bestattung zum Zeitpunkt der
Auflassung der Höfe im Verlauf des 3. Jh. n.Chr. manifestieren.
Selbst losgelöst von derartigen Großmonumenten oder speziellen Kultbauten sind
schließlich aus Villenarealen eine ganze Anzahl von Kleinreliefs/-skulpturen
und -altären bekannt. Unter den verehrten Gottheiten befindet sich nicht selten
Fortuna, die beispielweise aus Haupthäusern, Badegebäuden und schließlich wiederum
Brunnen in Bad Rappenau-Babstadt (Kr. Heilbronn / BW), Korntal-Münchingen (Kr.
Ludwigsburg / BW), Oberndorf-Bochingen a. N. (Kr. Rottweil / BW), Pforzheim-Brötzingen
(Stadt Pforzheim / BW) oder Weinsberg; Kr. Heilbronn (BW) bekannt ist. Des
weiteren liegen etwa Hinweise auf eine Verehrung der Epona u.a. aus Bad Rappenau-Babstadt
(Kr. Heilbronn / BW) oder Sachsenheim-Großsachsenheim (Kr. Ludwigsburg / BW)
sowie ein Dioskurenrelief aus Stammheim (Kr. Calw / BW) oder ein Relief des
Merkur aus einem Wirtschaftsgebäude in Lauffen a. N. (Kr. Heilbronn / BW) vor.
Unter Einbeziehung vermuteter und prospektierter Gutshöfe ließe sich diese
Liste noch entsprechend weiter fortsetzen.
Zu den charakteristischen Elementen der Villae rusticae in den Nordwestprovinzen gehört die Einfriedung des bebauten Hofareals mit einem Zaun, einer Hecke, einem Graben oder einer Mauer. Wo der Unfang der Untersuchungen einen Beurteilung zuläßt, sind auch bei den Gutshöfen im Betrachtungsgebiet in der Regel Umfriedungen nachzuweisen. Ausnahmen könnten lediglich die oben näher beschriebenen Kleinst- bzw. Kompaktgehöfte darstellen, bei denen mitunter allerdings schon das Haupthaus hinsichtlich seiner Bauweise eine in sich abgeschlossene Version von Wohn-, Wirtschafts- und Hofbereich bildet. Wie ein recht gut untersuchtes Beispiel aus Wurmlingen (Kr. Tuttlingen / BW) nahelegt, scheinen derartige Anlagen, selbst wenn im Verlauf ihres Bestehend noch das eine oder andere Nebengebäude zum Haupthaus hinzukam, zum Teil keinerlei nachweisbare Umfriedung besessen zu haben. Bei den übrigen Villae rusticae sind demgegenüber fast ausschließlich gemauerte Einfriedungen nachgewiesen. Dies mag in erster Linie auf den ungleich besseren Kenntnisstand der Steinbauperioden gegenüber den gelegentlich vorausgegangenen Holzbauphasen der Gutshöfe beruhen. Wo letztere etwas besser bekannt sind, konnten, wie immerhin etwa in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kr. / BW), Oberndorf-Bochingen a. N. (Kr. Rottweil / BW) oder Walldorf (Rhein-Neckar-Kr. / BW), auch Gräbchen von Zaun- bzw. Palisadenumfriedungen festgestellt werden.
Holzbauphase der Villa rustica von Bondorf
|
Gutshof von Oberndorf-Bochingen a. N.
|
Villa rustica von Bruchsal-Obergrombach
|
Mit abschnittsweise zweireihigem Verlauf dienten sie während der Holzbauphase einer Villae rustica in Bondorf (Kr. Böblingen / BW) eventuell sogar gleichzeitig als Hofbegrenzung und Viehgehege. Eine mögliche Kombination aus Graben-/Palisadenabschnitten im Wechsel mit einer Steinmauer wird schließlich bei einer Anlage in Bruchsal-Obergrombach (Kr. Karlsruhe / BW) vermutet, deren Umfassungsmauern zum Teil abrupt abbrechen. Wie manche der genannten Beispiele erkennen lassen, folgen die jüngeren Hofmauern, sofern keine Erweiterung des Hofes erfolgte, oft ziemlich genau den älteren Begrenzungen, was deren Nachweis zum Teil unmöglich macht. In der Regel umschließen sie ein mehr oder minder rechteckiges, leicht rautenförmiges oder trapezoides Areal. Wie u.a. Befunde aus Bondorf (Kr. Böblingen / BW) und Mundelsheim (Kr. Ludwigsburg / BW) verdeutlichen, waren die Mauern gelegentlich mit Fugenstrich versehen und besaßen eine gedeckte Mauerkrone. Während in Mundelsheim eine Abdeckung aus Sandsteinplatten verwendet wurde, benutzte man etwa in Bondorf und Hechingen-Stein (Zollernalbkr. / BW) Dachziegel.
Villa rustica "Ziegelscheuer" in Ladenburg;
Toranlage
|
Villa rustica am Hedwigshof bei Ettlingen; Toranlage
|
Villa rustica in Tengen-Büßlingen; Torbereich mit "Pförtnerhaus"
|
Im Zugangsbereich der Gutshöfe kommen, abgesehen von einfachen Durchlässen,
vereinzelt auch akzentuierte Torwangen, so etwa in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kr.
/ BW), oder gar ausgeprägte Torbauten, wie in Pforzheim-Hagenschieß (Stadt
Pforzheim / BW) oder Ettlingen (Kr. Karlsruhe / BW), vor. Das Tor flankierende
Gebäude, beispielsweise in Tengen-Büßlingen (Kr. Konstanz / BW) und Heitersheim
(Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW), werden zum Teil als Verwalter- oder auch
Torwärterhäuser interpretiert.
Außer den Umfassungsmauern sind auf mehreren Villae rusticae auch Mauerzüge
vorhanden, die das Hofareal durchschneiden. Je nach Geländetopographie mag
es sich dabei in einigen Fällen, wie vielleicht bei einem unmittelbar vor dem
Einschnitt des Moseltales gelegenen Gutshof in Winningen (Kr. Mayen-Koblenz
/ RLP), um Hangsicherungs-/Terrassierungsmauern handeln. Demgegenüber dienten
beispielweise Mauern in Bietigheim-Bissingen (Kr. Ludwigsburg / BW), Ludwigsburg-Hoheneck
(Kr. Ludwigsburg / BW) oder Weitersbach (Kr. Birkenfeld / BW) eindeutig der
Abteilung einzelner Wirtschaftsareale, u.a. eventuell zu viehhalterischen Zwecken.
Gutshof von Winningen
|
Villa rustica von Weitersbach
|
 Auf
eine mögliche Separierung repräsentativer Garten- bzw. Parkanlagen deuten schließlich
Mauern bzw. Abschnittsmauern hin, die, wie in Ettlingen (Kr. Karlsruhe / BW)
und bedingt auch in Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW), unter
Anbindung an das Haupthaus, weitgehend unbebaute Freiflächen auf dessen Rückseite
vom Wirtschaftsteil des Hofes isolieren. Ihre Funktion kommt der von Trennmauern
zwischen der Pars rustica (Wirtschaftsteil) und Pars urbana (Wohnteil), die
etwa bei Höfen vom Axialschema im schweizerischen Teil von Obergermanien mehrfach
belegt sind, schon sehr nahe.
Auf
eine mögliche Separierung repräsentativer Garten- bzw. Parkanlagen deuten schließlich
Mauern bzw. Abschnittsmauern hin, die, wie in Ettlingen (Kr. Karlsruhe / BW)
und bedingt auch in Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW), unter
Anbindung an das Haupthaus, weitgehend unbebaute Freiflächen auf dessen Rückseite
vom Wirtschaftsteil des Hofes isolieren. Ihre Funktion kommt der von Trennmauern
zwischen der Pars rustica (Wirtschaftsteil) und Pars urbana (Wohnteil), die
etwa bei Höfen vom Axialschema im schweizerischen Teil von Obergermanien mehrfach
belegt sind, schon sehr nahe.
Gutshof in Heitersheim; stark schematisierter Gesamtplan der Bauphase III
Abgeteilte Areale sind letztlich jedoch nicht nur auf den Kernbereich der Villae
rusticae beschränkt, sondern schließen sich gelegentlich auch als umfriedete
Annexe an die Außenseite der Hofmauer an. Während es sich bei zahlreichen
leichten Mäuerchen vor dem Südabschnitt der westlichen Gutshofmauer in Ludwigsburg-Hoheneck
(Kr. Ludwigsburg / BW) vermutlich um Viehpferche handelt, bleibt die Funktion
eines gewaltigen Mauerannexes an der Westseite einer Villa rusticae in Bondorf
(Kr. Böblingen / BW) unklar.
Gutshof von Ludwigsburg-Hoheneck;
3. Bauphase |
Villa rustica von Bondorf;
Steinbauperiode |
Da seine Südbegrenzung noch nicht archäologisch erfaßt wurde, ist nicht auszuschließen, daß er fast noch einmal die gleiche Fläche einnahm, wie der Kernbereich der Villa. Sofern es sich nicht um Stützpfeiler handelt, könnten zudem drei Maueranschlüsse an der südlichem Hofeinfriedung auf zwei weitere umgrenzte Außenareal hindeuten. Das eine hätte dann zumindest einen in diesem Bereich nachgewiesenen Kalkbrennofen enthalten. Hingegen sind wirkliche Gebäudestrukturen innerhalb äußerer Annexe im Arbeitsgebiet bislang kaum bekannt. Immerhin kann hier auf die im Zusammenhang mit den Heiligtümern schon behandelte "Götterhalle" verwiesen werden, deren trapezoide Umfassungsmauer an die Nordwestecke eines Guthofes in Eutingen-Rohrdorf (Kr. Freudenstadt / BW) anbindet. Soweit die ergrabenen Mauerzüge Schlußfolgerungen gestatten, begrenzte der Kultbezirk möglicherweise einen weiteren Annex im Westen des Hofes. Ein derzeit singulärer Baubefund liegt schließlich auch aus einer Villa in Kirchheim a. N. (Kr. Ludwigsburg / BW) vor.
Haupthausbereich eines Gutshofes in Kirchheim
am Neckar
|
Im Bereich eines hier exakt in der Achse der westlichen Hofmauer errichteten Badegebäudes deuten zwei nach Westen abgehende, nicht weiter verfolgte Stichmauern eventuell auf einen äußeren Annex hin, während im Osten ein mehreckig um das Gebäude herumgeführter Mauerzug mit Pforte das Bad vom restlichen Hofareal abschneidet. Aus welchen Gründen diese Separierung erfolgte und wozu die potentielle Annexfläche westlich der Therme diente, ist ungewiß.
[ ]
SANC[ ] (S)ANCTINI
ET SANCT(E)I ATTICI
-----------------------------
PRIS(C)[ ](I)VS
CLIEN[ ](I)
CVST[ ]
(R)[ ]
Eine mögliche Rekonstruktion der Inschrift besagt, daß ein gewisser Priscus, bei dem es sich um den derzeitigen Pächter (cliens) und möglicherweise ehemaligen Verwalter (custos) des Gutshofes handelt, den Mosaikboden zu Ehren des Sancteius Sanctinus und Sancteius Atticus, bei denen es sich wohl um die Besitzer des Anwesens handelt, verlegen ließ (siehe dazu u.a. Rothkegel 1994, 43f.). Gentilnamen wie Sanctus, Sanctius, Sancteius oder Sanctinus sind in der unmittelbar benachbarten Schweiz offenbar häufig in Zusammenhang mit einheimischen Personen belegt (siehe Jahrb. SGU, 1939, 96f.). Somit kämen hier vielleicht zwei Brüder aus einer romanisierten Helvetier- oder Raurakerfamilie als Villenbesitzer in Frage. Die Inschrift verdeutlicht zudem, daß einerseits eine luxuriöse Ausstattung des Haupthauses nicht zwangläufig auf eine lokale Präsenz des Besitzers hindeutet und sich andererseits Pachtobjekte nicht immer zwangsläufig durch eine bescheidenere Gestaltung auszeichnen müssen.
Villa rustica in Laufenburg;
Grabungsphoto und Umzeichnung |
Altar zur Jupitersäule der Villa rustica von Niefern-Öschelbronn
|
Weitere Hinweise auf Villenbewohner sind mitunter auch in Weiheinschriften auf Monumenten, wie etwa den im Betrachtungsgebiet häufig vorkommenden Jupitersäulen belegt. So ist beispielsweise in Verbindung mit einer solchen Säule vom Areal eines Gutshofes in Niefern-Öschelbronn (Enzkr. / BW) ein Altar des späten 2./frühen 3. Jh. n.Chr. mit folgender Inschrift bekannt: "Zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses, Jupiter, dem Besten und Größten, hat Valeriana, die Schwester, für Maternus Marcianus als Einlösung eines Gelübdes (das Monument) gesetzt, froh, gern und wie es sich gebührt". Die Namen Maternus und Marcianus sind im Rhein- und Neckargebiet häufiger belegte (siehe u.a. Fischer 1925-1928). Ob es sich bei der Familie um die Besitzer oder nur um Pächter des Anwesens handelt, geht aus der Inschrift nicht hervor.
Gutshof von Heitersheim; Keramikfunde
|
Genauso unklar bleibt letztlich auch die Stellung der Person, die auf dem
Gutshof von Heitersheim (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald / BW) eine lokale Keramikproduktion
unterhielt und einen Teil der Ware mit "L. I[---]" stempeln bzw.
mit "FONTI" handsignieren ließ oder gar selbst entsprechend kennzeichnete.
Bei einer Zuweisung der Namensfragmente ist hier ebenso an den Besitzer oder
Pächter des luxuriösen Gutes zu denken wie beispielsweise an einen im Auftrag
des Bewirtschafters vor Ort tätigen Töpfer, der vielleicht Überschüsse signierte
und auf eigene Rechnung veräußern konnte.
Gräber
Über die zwangsläufig zu jedem Gutshof gehörenden Gräberfelder ist bislang
im Betrachtungsgebiet recht wenig greifbar, sofern man von Grabgruppen ohne
eindeutige Zugehörigkeit zu einer untersuchten und als Villa rustica identifizierten
Siedlungsstelle absieht. Zu einem gewissen Teil macht sich hierin vielleicht
die bislang nur ausschnitthafte Erfassung der meisten Gutshöfe bemerkbar. Von
Ausnahmen abgesehen, wie beispielsweise einigen Brandgräbern aus der Zeit der
Holzbauphase eines Landgutes in Oberndorf-Bochingen a. N. (Kr. Rottweil / BW),
die an der Hofmauer des erweiterten Areals der jüngeren Steinbauphase gefunden
wurden, deuten allerdings auch annähernd vollständig erforschte Anlagen darauf
hin, daß innerhalb der Hofeinfriedungen und unmittelbar davor in der frühen
und mittleren Kaiserzeit wohl nur in begrenztem Maße mit Bestattungen zu rechnen
ist. So liegen etwa die den Villen am Annaberg in Bad Dürkheim (Kr. Bad Dürkheim-Weinstraße
/ RLP), Boos (Kr. Bad Kreuznach / RLP), Heidesheim (Kr. Mainz-Bingen / RLP),
Katzenbach (Donnersberg-Kr. / RLP) und Wachenheim (Kr. Bad Dürkheim-Weinstraße
/ RLP) wahrscheinlich zuordenbaren Gräber teils zwischen 100 m und 400 m vom
Gutshof entfernt. In der Regel handelt es sich bei ihnen um Brandbestattungen.
Auch zu den Grabbauten gibt es derzeit nur wenige Anhaltspunkte. Außer möglichen
Grabhügel in der Nähe einer Villa in Weiterbach (Kr. Birkenfeld / RLP), ist
etwa für fünf Steinbauten, die in rund 800 m Entfernung von einem Landgut in
Kirchheim a. N. (Kr. Ludwigsburg / BW) entdeckt wurden, bisweilen eine Interpretation
als Grabtempel vorgeschlagen worden. Alternativ könnte es sich bei den einräumigen
Steingebäuden mit Hinweisen auf eine Skulpturenausstattung jedoch auch um Bauten
eines kleinen Kultbezirkes handeln.
Gesamtplan der potentiellen Grabtempel im Schloßwald
|
Grabskulpturengruppe aus dem Umfeld der Villa rustica
|
 Ein
sicherer Beleg für das Vorkommen einer zum Teil recht aufwendigen Grabarchitektur
im Umfeld der Gutshöfe stammt hingegen aus Rothselberg (Kr. Kusel / RLP). Über
einem 2,7 m auf 1,5 m großen Fundament erhob sich hier ein vermutlich altarförmiges
Monument, auf dessen Oberseite drei steinerne Skulpturengruppen Platz fanden.
Während die mittlere einen Löwen über seiner menschlichen Beute zeigt, bestehen
die beiden flankierenden Gruppen jeweils aus einem Eber, der ein Schwein zwischen
den Läufen hält. Wie auch in einer Kirche auf dem Areal des Gutshofes in Medard
(Kr. Kusel / RLP) eingemauerte Blöcke mit Ranken-/Tierdekor und einer Szene
aus dem Medeazyklus zeigen, kamen solche aufwendigeren Grabmonumente wohl durchaus
häufiger vor. Aus Repräsentationsgründen muß mit ihrer Aufstellung, abgesehen
von einer erkennbaren Nähe zum jeweiligen Hofareal, wohl vor allem auch in
Sichtweite oder entlang nahegelegener Straßenzüge gerechnet werden. Es scheint
deshalb durchaus möglich, daß das Fundament eines aufwendigen Grabbaus in Karlsruhe-Durlach
(Stadt Karlsruhe / BW), das zusammen mit dem Grabstein des im Alter von 100
Jahren gestorbenen Veteranen Flavius Sterius unweit der römischen Straßenverbindung
Heidelberg-Basel entdeckt wurde, mit den Bewohnern eines unmittelbar jenseits
der Pfinz gelegenen Gutshofes in Verbindung gebracht werden muß.
Ein
sicherer Beleg für das Vorkommen einer zum Teil recht aufwendigen Grabarchitektur
im Umfeld der Gutshöfe stammt hingegen aus Rothselberg (Kr. Kusel / RLP). Über
einem 2,7 m auf 1,5 m großen Fundament erhob sich hier ein vermutlich altarförmiges
Monument, auf dessen Oberseite drei steinerne Skulpturengruppen Platz fanden.
Während die mittlere einen Löwen über seiner menschlichen Beute zeigt, bestehen
die beiden flankierenden Gruppen jeweils aus einem Eber, der ein Schwein zwischen
den Läufen hält. Wie auch in einer Kirche auf dem Areal des Gutshofes in Medard
(Kr. Kusel / RLP) eingemauerte Blöcke mit Ranken-/Tierdekor und einer Szene
aus dem Medeazyklus zeigen, kamen solche aufwendigeren Grabmonumente wohl durchaus
häufiger vor. Aus Repräsentationsgründen muß mit ihrer Aufstellung, abgesehen
von einer erkennbaren Nähe zum jeweiligen Hofareal, wohl vor allem auch in
Sichtweite oder entlang nahegelegener Straßenzüge gerechnet werden. Es scheint
deshalb durchaus möglich, daß das Fundament eines aufwendigen Grabbaus in Karlsruhe-Durlach
(Stadt Karlsruhe / BW), das zusammen mit dem Grabstein des im Alter von 100
Jahren gestorbenen Veteranen Flavius Sterius unweit der römischen Straßenverbindung
Heidelberg-Basel entdeckt wurde, mit den Bewohnern eines unmittelbar jenseits
der Pfinz gelegenen Gutshofes in Verbindung gebracht werden muß.
Warum sich vom einstigen Bestand entsprechender ländlicher Großgrabmäler nur noch so wenige Belege erhalten haben, illustriert recht gut der Fundort der oben erwähnten Architekturteile in der Kirche von Medard. Offensichtlich wurden die Bauten zum Teil bereits in spätrömischer Zeit als Quelle leicht zugänglichen, noch verwendbaren Baumaterials wieder abgebrochen.